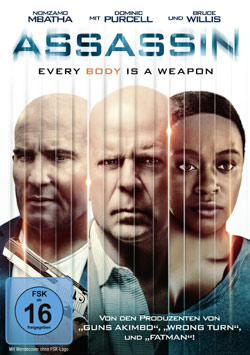| Originaltitel: Baby Blood__Herstellungsland: Frankreich__Erscheinungsjahr: 1990__Regie: Alain Robak__Darsteller: Emmanuelle Escourrou, Christian Sinniger, Jean-François Gallotte, Roselyne Geslot, François Frappier, Thierry Le Portier, Rémy Roubakha, Eric Averlant, Alain Robak, Alain Chabat, Jacques Audiard, Jean-Claude Romer u.a. |


Alain Robak weiß die Gesetze und Freiheiten des niederen Science-Fiction- und Horror-Kinos ganz offensichtlich zu schätzen und gedenkt sie in vollen Zügen auszukosten. Diese Feststellung lässt sich bereits nach Sekunden treffen. Ein zunächst körperloser Parasit erhebt in der Eröffnungssequenz von „Baby Blood“ mit scheußlich verzerrter Vocoder-Stimme Anspruch auf den Posten des Narrators. Gift und Galle spuckend kommentiert er den Anbruch eines neuen Zeitalters, während über Archivaufnahmen eines ausbrechenden Unterwasservulkans eifrig in der Ursuppe der Erdgeschichte gerührt wird. Keine Zeichen der Zurückhaltung, als der Geltungsrahmen abgesteckt wird; um die Hosen an dieser Story zu befestigen, sind größere Kaliber nötig als irgendein Apartment in der französischen Provinz. Äonen evolutionärer Menschheitsentwicklung beispielsweise.
Somit stranden die filmischen Referenzen im Rekordtempo vor der Kamera und häufen sich zu einem Berg unentwirrbaren Gekröses. Angeregten Dialogen zwischen Wirt und Parasit durften wir bereits in „Elmer“ (1988) lauschen, während Cronenbergs früher Body-Horror in Form wühlender Körperbewohner reinkarniert („Shivers“, 1975), ebenso wie in der Realisation verstörender Geburtssequenzen („Die Fliege“, 1986). Selbst Andrzej Zulawskis schlackernde Tentakel ertasten sich unter Begleitung der wahnsinnigen Schreie Isabelle Adjanis ihren Weg in Robaks Welt („Possession“, 1981). Und wie könnte man den tückischsten aller Körper-Invasoren aus einer solchen Aufzählung ausschließen, den Chestburster aus „Alien“ (1979).
Obgleich natürlich auch weniger somatische Referenzen gezogen werden, allen voran vielleicht „Rosemarie’s Baby“ (1968), bindet sich Robak nicht unbedingt an deren weit gefasste Kontextualisierung in Form weiterführender Diskurse. Nur weil der Horror in „Baby Blood“ das Ergebnis einer quasi unterbewussten Empfängnis ist, wird nicht etwa wie bei Polanski gleich das Okkulte zum Teil des Spiels. Ursprünge sieht das Skript ausschließlich in einer Darwin’schen Logik vom Überleben des stärksten Organismus. Das egoperspektivische Sichtfeld einer eingesperrten Bestie, die irgendwo im Dschungel zum Gegenstand eines Geschäfts zwischen Großwildjägern und Zirkus-Mitarbeitern wird, unterstreicht vielmehr den wilden Ursprung allen Lebens, den Komponist Carlos Acciari übrigens über den gesamten Film immer wieder mit Motiven aus der traditionellen afrikanischen Musik anreichert. Peter Jackson würde zwei Jahre später am anderen Ende der Erdkugel mit dem sumatrischen Ratten-Affen aus „Braindead“ auf vergleichbare Weise das Exotische plündern, um die Sauerei mit Blutbeuteln und Gedärmen dann völlig auf die Spitze zu treiben.
Aus der Ungebundenheit heraus gewinnt Robak Freiheiten, die er vollständig in ein zwangloses Road-Movie-Konstrukt investiert. Nicht umsonst gleicht der Parasit äußerlich einer Schlange. Seine Trägerin häutet sich mit jeder Durchgangsstation, lässt die tote Hülle zurück und wird in eine neue Situation hineingeboren. Ein Aufbau, der letztlich auch positiv auf das Sehvergnügen auswirkt. Das Drehbuch verfängt sich dadurch nämlich nicht in endlosen Zirkulationen an ein und demselben Ort, sondern sucht immer wieder den Sprung nach vorn ins Ungewisse. Bemerkenswert ist dabei der Fokus auf das Wesentliche: Wenn die Hauptfigur nach einer weiteren „six mois plus tard“-Tafel plötzlich als Bedienung in einem Café aus einem völlig neuen Ort in Erscheinung tritt, dann hat man das eben mit der gleichen Spontanität zu akzeptieren, die Yanka dazu bewegte, einen neuen Abschnitt ihres Lebens zu beginnen. So kommt der Regisseur dazu, trotz der relativ kurzen Laufzeit von unter 90 Minuten eine Geschichte von übergreifenden Ausmaßen zu erzählen.
Schaut in den Trailer zu “Baby Blood”
httpv://www.youtube.com/watch?v=tGIzAnsYVhg&feature=youtu.be
Zugleich macht sich die gelebte Unabhängigkeit in einer unbändigen Lust am Filmemachen bemerkbar, die sich keinerlei Dogmen beugt. Obwohl „Baby Blood“ in tristen Farben gefilmt ist und im Kern wohl als psychologisches Drama bezeichnet werden muss, quillt er über vor experimentellen Kamerafahrten, ungewöhnlichen Schnitttechniken und natürlich den farbenfrohen Splatter-Tüpfeln als finale Garnitur. Naturalistisch in der visuellen Ausleuchtung, erfreut sich der Inszenierende immer wieder wie ein kleines Kind über den gelegentlichen Einbruch des Phantastischen in den tristen Alltag langweiliger französischer Dörfer. Gelegentlich trägt es den Übereifer so weit, dass der Tonfall sogar ins Komödiantische fällt, wenn beispielsweise arglose Passanten zufällig die Wege mit der blutdurstigen Furie kreuzen und ähnlich linkisch vor den folgenden Gemetzeln davonlaufen wie die Schlossbesucher in Polanskis „Tanz der Vampire“.
Was alles nicht bedeutet, dass „Baby Blood“ einfach „nur“ als schriller Horrorfilm und Wegbereiter für spätere französische Extremwerke wie „Inside“ seine Berechtigung genießt. Nicht zuletzt Hauptdarstellerin Emmanuelle Escourrou ist es zu verdanken, dass sich die Eskalationen zum Teil lesen lassen wie der Erfahrungsbericht einer verzweifelten Alleinerziehenden, die mit ihrer Last von Gott und der Welt im Stich gelassen wird. In ihrem Fatalismus gleicht sie einer Béatrice Dalle, die in „Betty Blue“ von einem Tag auf den anderen lebte, ohne dass man zu je einem Zeitpunkt hätte wissen können, wie sie als nächstes über ihr Leben entscheiden wird. Ungezügelt lässt sie den Expressionismus walten: Das Haar wild zerzaust, das Handeln fremdgesteuert, der aufkeimende Wahnsinn wie salzige Tränen in den Augen stehend. Ihre Sexualität setzt sie als Instrument mit ungeschickter Hand, aber dennoch erfolgreich ein, um den Befehlshaber in ihren Eingeweiden mit dem lebensnotwendigen Blut versorgen zu können. Schönheit und Hässlichkeit spiegeln sich in ihrem Gesicht wie die beiden unvereinbaren Seiten eines Kippbildes, während sie die Weiblichkeit als Lebensspenderin symbolisiert. Da sich keine Neben- oder auch nur Randfigur für ihre Person interessiert, fällt nicht nur ihre Besessenheit nicht auf, bis sich mal wieder ein Messer ins Fleisch bohrt; zugleich breitet sich eine Anklage gegen sämtliche Mitmenschen im direkten Umkreis aus. Wenn man blutbesudelt in eine Werkstatt spazieren kann, ohne auch nur vom Mechaniker registriert zu werden, dann ist es schließlich kein Wunder, wenn es die Kreatur mühelos an ihr Ziel schafft, um final die Menschheit auszurotten.
Alain Robak ist sicherlich kein Picasso seines Fachs; alles, was er sich einfallen lässt, haben Andere vor ihm bereits mit höherer Relevanz und andere nach ihm mit noch mehr Konsequenz umgesetzt. Die Natürlichkeit, mit der er seine persönliche Vision des invasiven Horrorfilms zu einem evolutionären Prozess erklärt, führt aber zu einem berauschenden, unberechenbaren und jederzeit aufregenden Filmerlebnis, das mal morbide, verstörend oder auch lächerlich ausfällt, in jedem Fall aber die Aufregung einer brausenden Fahrt unter freiem Himmel erzeugt.
Gute
![]()
Informationen zur Veröffentlichung von “Baby Blood”


Die DVD- und Blu-ray-Ausgabe als “Drop Out 036” von Bildstörung.
Drop Out 036
Die Zeit sei noch nicht reif gewesen, konstatiert Hauptdarstellerin Emmanuelle Escourrou über „Baby Blood“ in einem Interview Jahrzehnte nach Entstehung des Films. Hoffen wir, dass die Zeit inzwischen reif ist, denn Bildstörung veröffentlicht den zum Kult avancierten Horrorfilm nun im Rahmen der „Drop Out“-Serie als Nr. 36.
Damit folgt man zeitlich dicht hinter der US-Veröffentlichung von Kino Lorber aus dem Oktober diesen Jahres, welche allerdings schlechter ausgestattet scheint: dort wird abgesehen vom Trailer lediglich ein Audiokommentar mit Filmhistoriker Lee Gambin und Kritiker Jarret Gahan.
Die Herrschaften von Bildstörung standen indes schon viele Wochen vor Release in engem Kontakt mit Regisseur Alain Robak und haben mit dessen Unterstützung ein dickes Paket geschnürt, das nun in Form einer Blu-ray+DVD-Special-Edition zu erwerben ist.
Die Verpackung
Wie gewohnt muss man bloß Ausschau halten nach einer großformatigen Scanavo-Verpackung mit Pappschuber und Umschlag mit blauer Banderole. Das psychedelische Frontcover zeigt die Hauptdarstellerin mit blutverschmierten Händen und Babybauch, die von verwackelten Schrei-Aufnahmen ihrer selbst umgeben ist. Klassisch schön ist dieses Artwork nicht unbedingt, aber es macht den Geisteszustand deutlich, in dem sich die Figur über den gesamten Film befindet. Oben links auf dem Umschlag befindet sich ein roter „30th Anniversary“-Button, der noch einmal vor Augen führt, dass dieser Film tatsächlich schon drei Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Der Pappschuber ist selbstverständlich frei von sämtlichen Buttons, Logos und sonstigen Störfeuern, lediglich ein dezenter Rahmen ziert das obere und untere Ende des Motivs. Auf dem Backcover geben ein paar wilde Screenshots schon mal einen Vorgeschmack auf das zu Erwartende, eine Inhaltsangabe und mehrere Kritiker-Zitate sollten ebenso wie eine Auflistung der Bonus-Features bei der Entscheidungshilfe befindlich sein.
Weil das eigentliche Artwork bereits auf dem Schuber platziert ist, kommt die Amaray mit einem breitflächigen, d.h. über Rück- und Vorderseite verlaufenden Szenenbild von Yanka, die am Bahnhof ihren Satansbraten empfängt. Innen wartet ein weiteres Szenenbild von einer Kassentheke.
Das Booklet
Ferner enthalten ist wie immer ein 28-seitiges Begleitheft, das neben einigen Szenenfotos drei Texte enthält:
– Der Medienwissenschaftler Jochen Werner erläutert zunächst seinen persönlichen Zugang zum Film aus Jugendtagen und macht sich dann an die Analyse, der er sich von der Inhaltsangabe ausgehend über das Emotionale annähert, indem er untersucht, was die Zwiegespräche zwischen Yanka und der Kreatur für das Menschliche bedeuten. Im Epilog beleuchtet er dann das Vermächtnis des Films – nicht nur in Form des direkten Sequels von 2008, sondern auch anderer thematisch ähnlich gelagerter Filme wie „The Unborn II“.
– Ariel Esteban Cayer, der schon im Booklet zu „Luz“ in Erscheinung getreten ist, übernimmt mit seinem an Teruo Ishiis „The Horrors of Malformed Men“ angelehnten Aufsatz „The Horrors of Fully Formed Men“ und geht noch wesentlich weiter. Ausgehend von Barbara Creeds Essay „Horror and the Monstrous-Feminine“, ordnet er „Baby Blood“ als wichtiges Puzzleteil des Horrors des Weiblichen ein. Der sei sich seiner Relevanz aber gar nicht bewusst, weil er ja hauptsächlich am spielerischen Aspekt des Splatterfilms interessiert sei – und vielleicht auch ein wenig an der erotischen Komponente.
– Christian Kessler zuletzt arbeitet ausgiebig mit der Genre-Einordnung eines Grenzgängers, der sich damals gar nicht in einer Genre-Blase befinden konnte, weil das Genre in dieser Form in Frankreich gar nicht so recht existierte.
Die Blu-ray
Auf der Blu-ray selbst finden wir an Extras lediglich den Audiokommentar mit Hauptdarstellerin und Regisseur vor. Es ist eine von insgesamt vier Tonspuren, denn neben der deutschen Synchronisation finden wir auch den französischen und englischen Ton, allesamt abgemischt in DTS-HD Master Audio 2.0 Stereo und von einer Qualität, die allen Anforderungen genügt. Insbesondere die Gespräche zwischen Yanka und ihrem Ungeborenen sind von einer markanten Schärfe geprägt, aber auch sämtliche Effekte und Umgebungsgeräusche kommen sehr gut zur Geltung. Noch besser sieht das Bild aus: Nachdem die ersten Aufnahmen durch das Stpck Footage ausbrechender Vulkane selbstverständlich sehr grobkörnig und unscharf ausfallen, wird man im folgenden Zeuge von einigen erstaunlich brillanten Einstellungen, die bei der Farbwiedergabe, Schärfe und Natürlichkeit des Bildes (in Form einer natürlichen Körnung) durchaus begeistert. Nicht jede Szene kann diese Qualitäten immer halten, was vor allem an den oft schwierigen Lichtbedingungen (viele Schwarzanteile) und den vielen verschiedenen Drehorten liegt, doch insgesamt wird hier ein vorzüglicher Transfer geboten, der das Filmerlebnis massiv aufwertet.
Die DVD
Die weiteren Extras finden sich gesammelt auf der Bonus-DVD. Aus dem Treffen mit den Drehbeteiligten Alain Robak (Regie), Dernard Déchet (Kamera), Emmanuelle Escourrou (Yanka), Jean-François Gallotte (Richard) und Christian Sinniger (Lohman) wurde insgesamt über eine Stunde an Interview-Material geschnitten. Bei den Darstellern fällt auf, dass diese wohl überwiegend „irgendwie aus Versehen“ in die Schauspielerei hineingerutscht sind, was vermutlich viel darüber aussagt, wie B-Movies dieser Sorte produziert wurden. Das Interview mit Escourrou hat natürlich die längste Dauer, wo das Interesse an der Hauptfigur naturgemäß am höchsten ist. Am ergiebigsten ist vermutlich das Interview mit Robak, denn aus seinen Erfahrungsberichten lässt sich viel darüber über die schwierigen Bedingungen für kleine Horrorfilmproduktionen im Frankreich der späten 80er ableiten.
Hochinteressant ist auch der „Location Trip“ mit Alain Robak als Tourguide. Verbunden durch pfiffige Kapitelübergänge per Google-Maps-Zoom, führt der Regisseur durch einige Schauplätze, die offenbar alle nur wenige Kilometer voneinander entfernt liegen, und saugt die Atmosphäre ein, die sich in vielen Fällen wohl kaum verändert hat – die gleichen Zäune, die gleichen Bänke. Dort, wo im Film der Zirkus steht, konnte man wohl auch bei der Besichtigung 30 Jahre später wieder zwei Zirkuszelte finden.

Alain Robak präsentiert die alten Drehorte.
So viel zum dokumentarischen und filmhistorischen Teil; die Disc hat aber auch noch mehr künstlerischen Output zu bieten.
Da wären zum einen drei Musikvideos, die nicht nur völlig unterschiedliche Musik zu bieten haben, sondern auch eine sehr vielseitige Regieführung. „Le Rififi“ ist ein klassisches Chanson mit leicht burleskem Charakter, in dessen Hintergrund außerdem noch eine kleine Geschichte vonstatten geht, bei der viele Kopfschüsse verteilt werden. Der Regisseur ist übrigens Teil der Band und zupft ziemlich gekonnt an der Klampfe. Auch in den anderen beiden Videos tritt er nicht nur hinter der Kamera, sondern auch musikalisch in Erscheinung: „La valse tordue“ ist ein reichlich surreales Schwarzweiß-Video, bei dem ein alternder Hampelmann mit nacktem Oberkörper in der Wüste Ausdruckstänze aufführt, während Robak die Finger über eine Slide-Gitarre gleiten lässt und sein Nebenmann am Kontrabass zupft. Jazzclub-Flair kommt dann im ähnlich gelagerten „Touchez pas au Grisby“ auf, der Stil und Augenzwinkern zu einer unwiderstehlichen Mischung macht.
Trailer zum Hauptfilm und Werbetrailer aus dem Programm sind natürlich auch noch dabei, doch Höhepunkt so vieler Veröffentlichungen von Bildstörung sind Kurzfilme. Derer haben es erfreulicherweise auch wieder zwei auf diese Edition geschafft. Mit einer Kurzbesprechung der überaus sehenswerten Arbeiten „Corridor“ (1989) und „Sado und Maso fahren Boot“ (1994) lassen wir diese Besprechung ausklingen.
Corridor

| Originaltitel: Corridor__Herstellungsland: Frankreich__Erscheinungsjahr: 1989__Regie: Alain Robak__Darsteller: Marie-Thérèse Caumont, Jean-Christophe Gallote, Jean-François Gallotte, Roger Zaconni |
Teuflischer hätte selbst der junge Sam Raimi seine Splatstick-Pointen nicht um Bruce Campbell herum drapieren können. Wie an einem Mäusefaden knabbert sich Alain Robak beharrlich von Zentimeter zu Zentimeter und lässt so eine geradlinige Struktur entstehen, die dem Titel „Corridor“ alle Ehre macht. Das ist vielleicht nicht besonders raffiniert und führt erst recht zu einer finalen Wendung, die man auf Meter voraus kommen sieht, doch mit Sicherheit verpuffen diese neun Minuten nicht ereignis- und wirkungslos; sie sind vollgestopft mit perfiden Fallen, die in der handwerklichen Umsetzung, in der musikalischen Akzentuierung und vor allem im präzisen Schnitt mit reinster Leidenschaft behandelt werden.
Eine besondere Erwähnung hat zudem der Schauplatz verdient, eine völlig heruntergekommene Bruchbude mit labyrinthischen Qualitäten, die von einer Kreuzung aus degenerierten Hinterwäldlern und Gothic-Sonderlingen kaum stilechter bewohnt werden würde. Dass das alte Haus laut Drehbuch als Preisgewinn ausgeschrieben ist, erlangt somit eine gewisse Glaubwürdigkeit. Wäre Jigsaw ein Franzose, hätte er sich der Gruppe an Interessenten sicher angeschlossen. Bei Marie-Thérèse Caumont, die ihren armen Besucher (völlige Überrumpelung: Jean-François Gallotte) mit einer frischen Tasse Kaffee in die Hölle jagt, hätte er jedenfalls noch so manchen Kniff lernen können.
Ob sich „Corridor“ ferner als Kommentar zur Situation des französischen Immobilienmarkts lesen lässt, ließe sich mit mehr Kenntnissen zur Situation Ende der 80er Jahre sicher besser sagen; in jedem Fall aber taugt er als Satire auf überfüllte Bewerbungsverfahren zur Hausbesichtigung auch heute noch.
![]()
Sado und Maso fahren Boot

| Originaltitel: Sado et maso vont en bateau__Herstellungsland: Frankreich__Erscheinungsjahr: 1994__Regie: Alain Robak__Darsteller: Jean-François Gallotte, Marina Tomé |
Bei dem bildhaften Titel stellt man sich zwei manische Cartoonfiguren im Stil französischer Comics der 60er und 70er vor, die wild fluchend in einem Boot sitzen und nicht dazu in der Lage sind, ihre Ruderbewegungen aufeinander abzustimmen, so dass sie sich ständig im Kreis drehen. Nach Sichtung von „Sado et maso vont en bateau“ stellt man dann fest, dass der Titel wahrlich nicht zu viel verspricht. Zwar handelt es sich bei Alain Robaks Viertelstünder weder um einen Trickfilm noch kommt ein Ruderboot in einem anderen Sinne vor als im metaphorischen, doch das mit der fehlenden Koordination wissen die Hauptdarsteller Jean-François Gallotte und Marina Tomé ausdrucksstark zu demonstrieren.
Minimalistisch im Schlafzimmer eines abgehalfterten Apartments angesiedelt, entwickelt sich die Anatomie einer Sadomaso-Bettszene schon bald in eine kontrastreiche Komödie. Während der Eine eigentlich nur „normalen“ Sex will, bevorzugt die Andere die härtere Gangart. Die fehlende Abstimmung der Sexualpartner führt dann zu einer abstrusen Abfolge aus Enttäuschung, Wut und daraus wiederum gewonnener Lust. Sie beschreibt die Anziehungskraft der Gegensätze zwar auf eine cartooneske (und in gewisser Weise typisch französische) Art und Weise, schwingt sich dabei aber durchaus bisweilen zu einer erstaunlichen Beobachtungsgabe für die Intensität ungleicher Beziehungen auf, die gerade durch Reibung Lebens- und Liebesqualität freisetzt.
Gallotte und Tomé erweisen sich während des asynchronen Liebesakts als talentierte Comedians, die regelmäßig überkochen wie vergessene Milchtöpfe auf dem Herd. Angesichts von aufgerissenen Stielaugen, die dumm durch eine Ledermaske glotzen, erscheint auch der finale Akt mit etwas härterer Gangart nicht mehr überzogen (Robak scheint eine generelle Vorliebe zu haben für Messer und Äxte, die durch Holztüren geschlagen werden).
Keine große Kunst, aber doch eine intelligent geschriebene und amüsant dargebotene Episode aus Frankreichs Hinterzimmern.
![]()
Sascha Ganser (Vince)
Bildergalerie von “Baby Blood”

Beim ersten Mal ist es noch schwer. Aber Yanke (Emmanuelle Escourrou) hat ja noch viel Zeit zum Üben.

Wer mit dem Blut-Baby auf Achse ist, muss zwischendurch auf jeden Fall mal ein Bad nehmen.

Die Kreatur in Yankas Bauch zieht es immer wieder zum Wasser.

Robaks Stammschauspieler Jean-François Gallotte im wohl schlimmsten 80er-Outfit, das die Vorstellungskraft hergibt.

Der Filmtitel verspricht nicht zu viel vom roten Nass.

Liebe Mütter, seid froh, dass euer Nachwuchs nur Milch verlangt.

Bon Appetit!

Ob medizinische Hilfe hier noch etwas ausrichten kann?

Männer kommen in Robaks Film nicht besonders gut weg.
Sascha Ganser (Vince)
Was hältst du von dem Film?
Zur Filmdiskussion bei Liquid-Love
| Copyright aller Filmbilder/Label: © 2019 EXO 7 PRODUCTIONS / STUDIOCANAL / Bildstörung__Freigabe: FSK18__Geschnitten: Nein__Blu Ray/DVD: Ja/Ja |