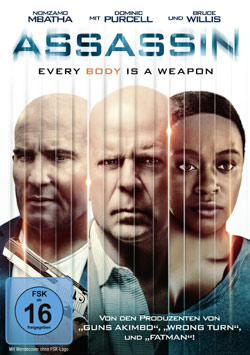| Originaltitel: The Harder They Fall__Herstellungsland: USA__Erscheinungsjahr: 2021__Regie: Jeymes Samuel__Darsteller: Zazie Beetz, Idris Elba, Regina King, Jonathan Majors, LaKeith Stanfield, Edi Gathegi, Tait Fletcher, Delroy Lindo, Mark Rhino Smith, RJ Cyler, Danielle Deadwyler, Deon Cole u.a. |


Das Poster von “The Harder They Fall”
Hart. Härter. Outlaw. Die finsteren Protagonisten des Wilden Westens fallen einem schnell ein, wenn es mal etwas rauer zugehen soll. Western-Motive sind vielseitig einsetzbar, man kann mit ihnen eine verloren gegangene Freiheit verklären, oder man verweist auf die verdorbenen Wurzeln heutiger Zivilisation, indem man Siedler des unerschlossenen Amerika eine hässliche Blutspur durchs Land ziehen lässt. Ganz egal, welche Stimmung man letztlich verfolgen möchte, der Verweis auf die Gegenwart ist immer vorhanden. Deswegen eignen sich Western-Anleihen auch so gut für kontemporäre Genres wie Großstadtthriller oder moderne Gangsterfilme, wo sie meist subtil unter der Oberfläche brodeln, beinahe so, als schlummerten die Gene der Cowboys und Gunslinger immer noch in der DNA ihrer Nachfahren, mögen diese auch anders sprechen und sich anders kleiden. Die neue Ordnung, mit der heute komplexe Großgesellschaften unter Kontrolle gehalten werden müssen, hat eben immer noch keinen richtigen Zugriff auf die Kriminellen am Rande des Systems. Das hat sich in den letzten 200 Jahren nicht geändert.
Wer Gegenwartskino produzieren und dabei trotzdem den „Good Ol’ West“ zelebrieren will, muss sich aber nicht zwangsläufig einfach nur mit seinem Geist zufrieden stellen. Filme wie „The Harder They Fall“ zeigen, dass es möglich ist, Revolverhelden, ihre Sechsschüsser und gleich ganze Geisterstädte beim Schopf zu packen und in unsere Zeit zu transportieren, so dass wir selbst nicht in die Vergangenheit reisen müssen.
Wer sich dafür entscheidet, die Gründer-Folklore aus ihrem Kontext zu lösen und stylisch zu verpacken, verscherzt es sich in der Regel nicht nur mit alteingesessenen Duke-Fans, sondern macht sich auch noch der postmodernen Allüren verdächtig. Erst recht gilt das, wenn man bedenkt, dass sich niemand Geringerer als Quentin Tarantino in den 2010ern bereits vollumfänglich der Dekonstruktion des Westerns verschrieben hatte. Was kann ein Jeymes Samuel, niemand Größerer als der kleine Bruder von Popstar Seal, nach diesem Jahrzehnt der Verknüpfung von Western und Popkultur auf dem Regiestuhl überhaupt noch beitragen?
Das Genre als solches trägt hingegen eine so unermessliche Weite in sich, dass sich Tarantino mit seinen zweieinhalb von zehn geplanten Filmen noch nicht einmal unbedingt zu exzessiv mit dem Thema befasst hat, weil es ja immerhin quasi das Fundament für den gesamten amerikanischen Film stellt. Insofern ist doch bestimmt noch ein wenig Platz für das Greenhorn, das jeder unterschätzt – und das dennoch ganz eigene Vorstellungen davon mitbringt, wie das Zeitalter der Outlaws ins Hier und Jetzt übersetzt werden könnte.
Was Samuel mit Tarantino in erster Linie verbindet, ist der Einsatz von Musik. Kein Wunder, machte er sich doch zunächst unter dem Pseudonym „The Bullits“ einen Namen als Musiker und nahm 2013 ein auf Western-Motiven beruhendes Album auf, das er gleichzeitig mit seiner ersten Regiearbeit multimedial veredelte, als er den passenden Kurzfilm „They Die By Dawn“ ablieferte. Besetzt mit hochkarätigen Darstellern wie Giancarlo Esposito, Michael K. Williams und Rosario Dawson, bekommt man hier schon einen Vorgeschmack auf den Hauptgang, der hiermit nachgereicht wird.
„The Harder They Fall“ jedenfalls besteht zur Hälfte aus Musik, und damit ist gleichermaßen der dominante Soundtrack wie die Geräuschkulisse gemeint, die ja schon im Filmtitel einen dumpfen Aufschlag voraussagt (kein Wunder, dass es zwei Boxerfilme waren, die zuvor bereits denselben Titel gewählt hatten). Setzt sich eine Figur in Bewegung, zieht sie auf der Tonspur stets einen deutlich hörbaren Schweif mit sich. Niemand macht einen Zug in der gleißenden Sonne, ohne dass der Zuschauer es bemerken würde. Es knarzt, es klickt, es kracht, und nur in den kurzen Augenblicken, wenn es der Meditation unmittelbar vor dem Klimax nutzt, herrscht religiöse Stille. Epochal ist für ein Langfilmdebüt nicht nur die 140-minütige Laufzeit, sondern auch gerade die brachiale Verzahnung von Bild und Ton, die zu einer – für eine Netflix-Premiere jedenfalls ganz bestimmt – enormen cineastischen Breite führt. Wohl keines der Stücke vom Soundtrack zeugt davon mehr als „Guns Go Bang“ aus der Feder von Jay-Z und Kid Kudi, das kongenial in die Title-Credits-Montage eingewoben wird. Pistolenschuss-Querschläger aus Hollywoods verstaubten Tonarchiven setzen sich durch rhythmische Anordnung zu einem Beat zusammen, der auch einer Best-Of-Yosemite-Sam-Compilation gut zu Gesicht stünde. An einer naturalistischen Abbildung von authentischen Landschaften mit neutraler Soundkulisse wie aus einem Western mit Kevin Costner oder Tom Hanks ist Samuel offensichtlich nicht interessiert, ihm geht es darum, den Mythos der bewaffneten Paradiesvögel mit Farbbomben aufleben zu lassen, was ihm dank des spürbaren Respekts vor den Ursprüngen der großen Klischees gelingt – all der High Noons, der Steppenläufer, der Italian Shots und Yee-Haws.
Schaut in den Trailer von “The Harder They Fall”
httpv://www.youtube.com/watch?v=ElAr8R2bRD4
Das färbt folgerichtig auch auf die Figuren ab. Es erklärt ihre äußerlichen Auffälligkeiten ebenso wie ihre simplen Beweggründe und schlussendlich den geradlinigen, überraschungsarmen Plot. Inhaltlich lässt sich wenig Progressives aus „The Harder They Fall“ lesen, was bereits an der Exposition abzulesen ist. Ein enigmatischer Antagonist, der als stummer Todesengel an die Holztür einer Familie klopft und sie beim Abendessen stört, um Verderben über sie zu bringen, der dennoch ein hilfloses Kind aus unerfindlichen Gründen in dieser Situation verschont, welches schließlich zum Erwachsenen heranwächst und während des Zeitsprungs brennende Rachegelüste in sich züchtet… Tarantino hatte die Niederungen des Genre-Films bereits in „Kill Bill“ mit denselben archaischen Mustern transzendiert, sogar für den Suspense der Eröffnungssequenz, in der Idris Elbas eiskaltes Charisma ideal zum Tragen kommt, hatte er in „Inglourious Basterds“ bereits die Blaupause gelegt. Nur ist es für Samuel eher Nebenertrag als zentrales Anliegen, die rostigen Mechaniken des B-Kinos auf Hochglanz zu polieren. In erster Linie, da geht es ihm darum, einen „Black Western“ zu machen, im weiteren Sinne also „Black Cinema“ zu betreiben.
Damit stellt er sich in die Tradition von Regisseuren wie Sidney Poitier („Buck and the Preacher“), Mario van Peebles („Posse“) und Antonio Margheriti („Take A Hard Ride“), einige wenige Aufständische, die auf ihre Weise auch versucht hatten, eine einseitige Rollenkultur durch afroamerikanischen Einfluss vielfältiger zu gestalten, die bis dahin fast ausschließlich von weißen Cowboys, weißen Banditen, weißen Sheriffs, weißen Richtern und weißem Bürgertum geprägt war. Samuel positioniert sich hier ziemlich radikal, denn seinen Cast kann man problemlos als „all-black“ bezeichnen, ohne dabei relevante Spielfiguren zu unterschlagen. Es ist nicht so, dass hier gute Schwarze gegen böse Weiße zum Duell antreten; nein, Protagonist und Antagonist, Verbündete und Widersacher, Sympathieträger und Hassfiguren, neutrale und zwielichtige Gestalten sind durchgängig mit Darstellern afroamerikanischer Herkunft besetzt. Sie kapern den Wilden Westen und übernehmen das Spiel der Weißen auf allen Positionen. Mit einer herben Note schwarzen Humors funktioniert in diesem Zusammenhang die einzige Szene, in der Weiße in ihrem eigenen Revier gezeigt werden: Dem Inneren einer ganz in Weiß gestrichenen und möblierten Bank, die wie sich wie ein Zaun um die selige Schafsherde spannt, regelrecht hypnotisiert von den Transaktionsgeschäften, während an der frischen Luft das wahre Leben ausschließlich unter Schwarzen stattfindet.
Und was ist das für eine illustre Versammlung da draußen. Regina King im düsteren „Spiel mir das Lied vom Tod“-Trenchcoat mit der Aura einer Totengräberin. Zazie Beetz (“Joker“), die mit Zylinder und buschigen Locken den Rock’n’Roll lebt wie ein weiblicher Slash. RJ Cyler als personifizierter Hochmut, ganz in Tradition des blutjungen Leonardo DiCaprio aus „Schneller als der Tod“. Lakeith Stanfield als der ruhende Pol, der wie ein Geist von einem Standoff zum nächsten schwebt und philosophische Bonmots über Spiel und Leben absondert. Der unverwüstliche Delroy Lindo (“Domino“), der einmal mehr versucht, den Irrsinn seiner Umgebung zu verstehen. Sogar ein Wayans-Spross stolpert in einer kleinen Rolle umher. Samuel investiert sehr viel, um all diese und noch viele weitere unterschiedliche Charaktere anhand ihrer einmaligen Silhouetten sichtbar werden zu lassen. Wer schon Frozen Screens mit Einblendung von Rollennamen und zugehöriger Punchline befürchtet hat, darf aufatmen, denn hier werden wesentlich geschmackvollere Methoden gefunden, den Zuschauer mit den Figuren bekannt zu machen.
Dabei reicht der Blick nur selten ins Innerste der Charaktere. Trotz des Aufwands, der investiert wird, um sie greifbar zu machen, interessiert sich der Film nicht allzu sehr für ihre menschliche Seite; sie sollen eben harte Konturen im Gegenlicht der knallenden Sonne bleiben. Es geht am Ende darum, die staubigen Straßen und Saloons mit ihnen in eine lebendige Open World zu verwandeln. Allenfalls die beiden Hauptfiguren werden etwas vielschichtiger gezeichnet. Idris Elba bekommt gewissermaßen die Gelegenheit, seinen Roland aus der misslungenen „Dark Tower“-Verfilmung noch einmal neu anzugehen und mischt einen guten Schlag „Mann in Schwarz“ in seine Rolle. Letztlich bleibt er wie seine Arbeitskollegen in Stereotypen gefangen und erreicht nie auch nur annähernd die Unergründlichkeit etwa eines David Carradine aus „Kill Bill“, aber er passt vortrefflich ins Ambiente und erfüllt als wortkarger Steinfels seine Funktion. Mit Hauptdarsteller Jonathan Majors verhält es sich ähnlich. Man versteht seine Motivation, doch sie ist nicht weiter von Belang. Es geht um den Weg, nicht um das Ziel, wie man so schön sagt.
Und dieser Weg wird dann doch mit erstaunlich versierter Hand geebnet. RZA hatte mit „The Man With The Golden Fists“ Vergleichbares in Bezug auf den Eastern vor, ließ aber das notwendige Handwerkszeug vermissen, um mehr zu bieten als eine schief gezimmerte Hommage, die sich fortwährend in ihren kleinen Gimmicks verlor und so selbst zum C-Movie wurde. „The Harder They Fall“ wirkt dagegen fast schon wie ein ausgereifter Blockbuster, ist er doch inszenatorisch bis zur letzten Pose durchkomponiert und hat einige frische Ideen im Zusammenspiel von Optik und Klang zu bieten, wie man sie man selbst in seriösen Western so lange nicht mehr gesehen und gehört hat. Es gibt Split Screens, sämtliche Einstellungsgrößen werden durchexerziert, Coolness in Zeitlupe gebannt. Die Sets wirken sicherlich ziemlich künstlich und ausstaffiert (was sie bei der Anlage allerdings dürfen), vom Drehbuch und den darin erschaffenen Charakteren sollte man sich keine besondere Tiefe erwarten und selbst bei den Stärken gehen dem Film manchmal die Pferde durch, wenn sich der Stil allzu penetrant über die Substanz stülpt. 140 Minuten haben sich aber definitiv schon länger angefühlt.
![]()
Am 6. Oktober feierte “The Harder They Fall” seine Weltpremiere als Eröffnungsfilm des London Film Festivals. Zwei Wochen später folgte eine Auswertung in ausgewählten US-Kinos. Nur einen Monat nach seiner Premiere ist der Western nun bereits im Programm von Netflix gelandet und auch von Deutschland aus abrufbar.
Bildergalerie

Hier bringt der Gast sein Besteck selber mit.

Handwerklich fällt “The Harder They Fall” mit seinen Splitscreens und ähnlichen Stilmitteln extravagant aus.

Nat Love (Jonathan Majors) leidet für die Rache.

Mal wieder gesündigt? Der Beichtstuhl der örtlichen Kirche freut sich auf Euren Besuch.

Bei der Inneneinrichtung empfiehlt es sich, etwaige Blutbäder lieber im Außenbereich anzurichten.

Zazie Beetz und Regina King gehören zu den widerborstigen Highlights der schillernden Besetzung.

1 PS vs. 5000 PS

Ein Italian Shot auf Idris Elbas Augen? Kann man sich doch nicht entgehen lassen!
Sascha Ganser (Vince)
Was hältst du von dem Film?
Zur Filmdiskussion bei Liquid-Love
| Copyright aller Filmbilder/Label: Netflix__FSK Freigabe: ungeprüft__Geschnitten: Nein__Blu Ray/DVD: Nein / Nein |