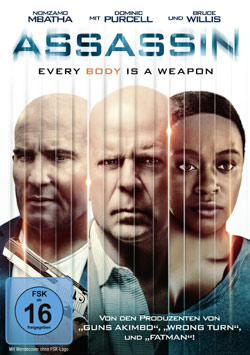Mit „The Flash“ startet auch DC offiziell ins Multiversum. Ezra Miller als Titelheld entdeckt seine Fähigkeit zum Zeitreisen, macht den Mord an seiner Mutter ungeschehen und erschafft damit eine alternative Zeitlinie, in der es kaum Superhelden gibt, die sich der Invasion durch General Zod entgegenstellen können. Comicverfilmung mit reichlich Anspielungen auf die DC-Geschichte und vielen Cameos.
| Originaltitel: The Flash__Herstellungsland: USA/Kanada/Australien/Neuseeland__Erscheinungsjahr: 2023__Regie: Andy Muschietti__Darsteller: Ezra Miller, Michael Keaton, Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston, Antje Traue, Kiersey Clemons, Maribel Verdú, Ben Affleck, Jeremy Irons, Saoirse-Monica Jackson, Rudy Mancuso, Temuera Morrison, Nicolas Cage, George Clooney, Nikolaj Coster-Waldau u.a. |

In dem DC-Multiversum-Film „The Flash“ gibt es reichlich Easter Eggs und Cameo-Auftritte
„The Flash“ – ein DC-Projekt mit langer, nicht immer schöner Geschichte. Ursprünglich 2014 angekündigt, lange in der Mache, nach Fertigstellung aufgrund widriger Umstände für vier Jahre auf Halde, bei Veröffentlichung ein angesichts der anstehenden DCU-Neuausrichtung ein Auslaufprodukt und dann noch ein Box-Office-Flop. Aber wie ist der Film an sich letztendlich?
Zuerst einmal handelt es sich zwar um den ersten Solofilm des Helden im DCU, aber keine klassische Origin Story. Wenn „The Flash“ beginnt, ist Barry Allen (Ezra Miller) bereits als Titelfigur aktiv und wird im Einsatz gezeigt. Alfred Pennyworth (Jeremy Irons), der Butler von Bruce Wayne (Ben Affleck) alias Batman, ruft ihn zur Hilfe, als ein Schurkeneinsatz ein Krankenhaus in Gotham zum Einsturz zu bringen droht und die Fledermaus gerade die Übelwichte verfolgen muss, die einen gefährlichen Virus gemopst haben. Also sprintet Barry in Überschallgeschwindigkeit los, rettet den Tag und diverse Babys. Das wirft das Publikum etwas ins kalte Wasser, etabliert aber schon einige Trademarks, etwa dass Barry sich jederzeit mit viel Essen versorgen muss, damit seiner Superpower nicht der Saft ausgeht.
Der private Barry ist dagegen keine so glorreiche Gestalt. Aufgrund seiner Superheldenaktivitäten kommt er regelmäßig zu spät zu seiner Arbeit als Forensikexperte, Freunde hat er quasi keine und sein Vater Henry (Ron Livingstone) sitzt für den Mord an Barrys Mutter Nora (Maribel Verdú) ein, den er aber nicht begangen hat. Einiges davon hatte der erste Flash-Auftritt in „Justice League“ angerissen, aber nicht weiter ausgeführt, aber letzten Endes merkt man, dass eine klassische Origin Story filmisch vielleicht ausgelutscht ist, aber eine größere Bindung zur Hauptfigur erzeugt. Zumal sich Barry trotz gleicher Hintergrundgeschichte vom Sprücheklopfer aus „Justice League“ zum grübelnden Einsiedler gewandelt hat, was der Film zwar erwähnt, aber nie erklärt.
Als Barry merkt, dass er durch die Zeit reisen kann, wenn er nur schnell genug läuft, will er sein Trauma ausradieren: Er verhindert den Mord an seiner Mutter, indem er dafür sorgt, dass sein Vater zur richtigen Zeit daheim ist. Damit erschafft er jedoch eine alternative Zeitlinie, in der es Superman nicht gibt, als General Zod (Michael Shannon) und seine Truppen zur Invasion der Erde ansetzen…
Schaut euch den Trailer zu „The Flash“ an

Barry Allen (Ezra Miller) alias Flash gibt es durch einen Sprung in eine alternative Zeitlinie gleich doppelt
Multiversen sind das Gebot der Stunde und „The Flash“ hätte Vorreiter sein können, ist aufgrund der zahlreichen Verschiebungen jedoch bloß Nachzügler. Dankbarerweise erschafft er nur eine alternative Zeitlinie und bleibt in dieser anstatt gleich Dutzende von Universen zu zeigen, wenngleich natürlich die Option angeteasert wird. Und wie so gut wieder Comichelden-Multiversum-Film versucht er einerseits die Möglichkeiten des Multiversums aufzuzeigen, um gleichzeitig davor zu warnen, was passiert, man mit der Zeitlinie spielt. Letzteres gelingt ihm tatsächlich sehr gut, gerade wenn für Barry am Ende eine bittere Erkenntnis steht, die in einer wahrhaft traurig-emotionalen Supermarktszene gipfelt. Das Familiendrama als Kern dieser Superheldenfilms ist also gelungen, passt zu diesem nachdenklicheren, traumatisierteren Barry Allen.
Allerdings gibt es Barry ja hier zweimal, denn als der Held im Paralleluniversum landet, trifft er ein anderes Ich, das glücklich mit Mutter und Vater aufgewachsen und zum labertaschigen Stoner-Dude im „Bill & Ted“-Modus geworden ist. Das sorgt dann für reichlich forcierte Humoreinlagen, die dem Publikum irgendwann ebenso sehr auf Keks gehen wie der junge Barry und seine Lurfi-WG dem älteren Barry. Vor allem aber stehen die teilweise klamaukigen Witzeleien (gerade wenn Jung-Barry seine Fähigkeiten erhält und erstmals ausprobiert) in einem ähnlichen krassen Kontrast zum ersten Background um Verlust und Schuldgefühle wie die Humor-Drama-Mischung in dem unausgewogenen „Thor: Love and Thunder“ von der Marvel-Konkurrenz. Vorbild scheint allerdings weniger diese Inkarnation des Hammer-Schwinger gewesen zu sein; wie schon bei „Justice League“ scheint eher die jüngste filmische Version der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft als Inspiration gedient haben – so lieferten die „Spider-Man: Homecoming“-Autoren John Francis Daley und Jonathan Goldstein gemeinsam mit Joby Harold („Transformers – Aufstieg der Bestien“) die Story, das Drehbuch schrieb dagegen Christina Hodson („Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn“). Andere Humoreinlagen sind dagegen gelungener, etwa wenn Barry seinen Schwarm in seine Wohnung lässt, vorher in Lichtgeschwindigkeit aufräumt, aber dabei einen Fehler macht.

Dreifach-Power: Die beiden Flashs und Supergirl (Sasha Calle)
Das Script baut zahlreiche Cameos, Easter Eggs und Anspielungen ein, von denen einige regelrecht brillant, aber nur für sehr erfahrene Zuschauer zu erkennen sind. So muss man etwa vom Faible von Produzent Jon Peters wissen, der in den 1990ern in diverse Warner-Produktionen – darunter auch den geplanten und abgesagten „Superman Lives“ von Tim Burton mit Nicolas Cage – einen Fight gegen eine Riesenspinne einbauen wollte (mit „Wild Wild West“ bekam er schließlich seinen Wunsch). Oder dass Eric Stoltz als Hauptdarsteller bereits Teile von „Zurück in die Zukunft“ abgedreht hatte, eher als Hauptdarsteller durch Michael J. Fox ersetzt wurde. Offensichtlicher sind dagegen die Besetzungen von anderen DC-Helden aus aktuellen und vergangenen Inkarnationen, mit Michael Keaton („The Protégé“) als gealtertem Batman in jener Alternativrealität, in welcher der größte Teil von „The Flash“ stattfindet. Das macht nicht nur aufgrund der Besetzung, sondern auch aufgrund der Figur-Anlage Laune, sieht man vielleicht von deren erstem Auftritt im Reinhold-Messner-Gedächtnislook ab. Immerhin erklärt er die DC-Multiversum-Regeln erfreulich anschaulich und ohne viel Expositions-Gelaber mit Spaghetti. Allerdings zeugt dies gewissermaßen auch davon, dass das Vertrauen in den Flash als Hauptfigur vielleicht nicht das größte war, wenn man sich die Screentime von Batman und die Gastauftritte anderer Justice-League-Heroen anschaut.
Tatsächlich gerät bei so vielen Anspielungen und Sidejokes der eigentliche Plot gern mal aus den Augen und so ist es dann auch bei „The Flash“. General Zod und seine rechte Hand Faora-Ul sind derartige Nachgedanken, dass Michael Shannon („Bullet Train“) und Antje Traue („Das Jerico Projekt“) beinahe aus „Man of Steel“-Restmaterial in den Film geschnitten scheinen (tatsächlich haben sie ihre erneuten Rollen aber abgedreht). In der Zeitlinie spukt zudem noch ein böser Butzemann herum, der erst gegen Ende wieder auftaucht und dessen Identität ziemlich erwartbar ist, wenn man schon mal den einen oder anderen Alternativrealitäten-Film gesehen hat. So ist nach der überlangen Exposition storytechnisch auch nicht allzu viel los, nach einigem Zurechtfinden in der Alternativrealität und dem Aufsuchen von Batman steht nur noch eine Befreiungsaktion an, ehe man dann beinahe schon direkt zum Showdown schreiten kann.

Ich bin Batman: Dank Paralleluniversum schlüpft Michael Keaton nochmals ins Fledermauskostüm
Besagter Showdown ist dann eine der Actionszenen, in denen sich Licht und Schatten abwechseln. Stets amüsant sind die Spielchen, die Flash während seiner Beschleunigung so treibt, vor allem in der kreativen Auftaktszene, die zwar nicht so spritzig wie die grandiose Quicksilver-Sequenz aus „X-Men: Days of Future Past“ daherkommt, aber schon ordentlich Laune macht. Weniger schön sind dagegen die unfertig wirkenden, für einen Film dieser Budgetklasse erschreckend schlechten CGI-Effekte in Kampfszenen. Gerade Supergirl (Sasha Calle) sieht bei jedem Kampfeinsatz wie eine Figur aus einem PC-Spiel aus, aber auch mancher Batman-Fight scheint nicht von einem Stuntman, sondern eher von Kollege Computer ausgeführt worden zu sein. Dementsprechend sind manche Set-Pieces wegen ihres Witzes und ihrer Kreativität memorabel, andere leider wegen ihrer grottigen Tricks.
Durchweg stark dagegen ist die Performance von Ezra Miller („We Need to Talk about Kevin“) in seiner Doppelrolle als tragischer Held und als dessen jüngeres Dude-Ich, das aber ebenfalls noch dazu lernt und zu reifen weiß. Dabei ist nicht nur sein Spiel stark, sondern gerade seine Interaktion mit Maribel Verdú („Pans Labyrinth“) in der Mutterrolle. Sie haben nur wenige gemeinsame Minuten, aber die haben gewaltigen Nachhall. Michael Keaton ist eine Bank, DCU-Veteranen wie Ben Affleck („Dazed and Confused“), Jeremy Irons („High-Rise“), Jason Momoa („Fast & Furious 10“) und Gal Gadot („Red Notice“) sind in mehr oder weniger großen Rollen gut aufgelegt. Sasha Calle („Schatten der Leidenschaft“) besitzt zwar Wichtigkeit für die Geschichte, bleibt aber sowohl drehbuchtechnisch als auch darstellerisch eine absolute Randerscheinung ohne Erinnerpotential – komplett verschenkt.
In seinen besten Momenten (Supermarktszene, verschiedene In-Jokes) ist „The Flash“ fast schon herausragend gut, in seinen schlechtesten Momenten (Stoner-WG, CGI-Supergirl) dagegen regelrecht grottig. Als Multiversum-Spaß wartet der Film mit einigen interessanten Gedanken und vielen witzigen Anspielungen auf, wodurch der Mainplot allerdings eine Nachgedanke bleibt, ebenso wie die Schurken. Klamaukiger Humor steht neben amüsanten Referenzen auf das bisherige Werk von Regisseur Andy Muschietti („Es“), Einfühlsames neben Plumpem. Eine sehr durchwachsene Angelegenheit, die weder als Sargnagel noch als Rettungsschlag für das in der Transformation begriffene DCU in Erinnerung bleibt.
![]()
Warner hat „The Flash“ am 15 Juni 2023 in die deutschen Kinos gebracht, ungekürzt ab 12 Jahren freigegeben.
© Nils Bothmann (McClane)
Was hältst du von dem Film?
Zur Filmdiskussion bei Liquid-Love
| Copyright aller Filmbilder/Label: Warner__FSK Freigabe: ab 12__Geschnitten: Nein__Blu Ray/DVD: Nein/Nein, seit 15.6.2023 in den deutschen Kinos |