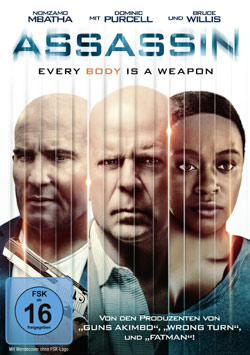| Originaltitel: Alien: Romulus__Herstellungsland: Großbritannien / USA__Erscheinungsjahr: 2024__Regie: Fede Alvarez__Produktion: Walter Hill u.a.__Darsteller: Isabela Merced, Cailee Spaeny, Archie Renaux, David Jonsson, Spike Fearn, Aileen Wu u.a. |


Das deutsche Poster von „Alien: Romulus“.
Die Sehnsucht nach solidem, ehrlichem Handwerk war groß, nachdem Ridley Scott mit seinen beiden Prequels zu „Alien“ einen philosophischen Alleingang gestartet hatte, dem viele Zuschauer nicht mehr folgen konnten. Fede Alvarez, der immer noch von seiner hochgradig effektiven Neuausrichtung der „Evil Dead“-Franchise aus dem Jahr 2013 zehrt, schien der richtige Mann zu sein, auch die „Alien“-Franchise aus ihrer Sackgasse zu manövrieren. Nichts wünschte man sich sehnlicher, als endlich wieder den nackten Terror im Angesicht des Xenomorph zu spüren, der sich aus der Kulisse schält, um seinen Ruf als das tödlichste Wesen der Kinogeschichte zu verteidigen.
Dabei ist schnell vergessen, dass „Alien“ immer schon mehr war als die perfekte Melange aus Science Fiction und Horror, mehr als die Summe der Mechanismen, die einen Zusammenschluss zweier kompatibler Genres bilden. Die Philosophische Anthropologie, die erlebbar zu machen sich Scott zuletzt zum Auftrag gemacht hatte, brütete immer schon in den grundlegenden Konzepten und Designs H.R. Gigers. Sie war der ungeborene, unausgesprochene Horror des ersten „Alien“, der vorgab, sich um den klassischen Feind von außerhalb zu drehen, den es zu vernichten galt. In Wirklichkeit aber drehte sich immer alles um den Menschen und um die Frage, was den Menschen und das Menschsein als vertraute Identität vom Fremdartigen trennt.
Solche weiterführenden Fragestellungen organisch in einen Suspense-Horrorfilm mit SciFi-Ambiente einzuweben, ohne sich wie Altmeister Scott in verquasten Monologen zu verhaspeln, hätte Alvarez‘ oberste Direktive sein müssen, um wahrhaftig zu den Anfängen der Reihe aufzuschließen. Disney und seiner 20th-Century-Abteilung wird es aber wohl weniger um die Fragestellungen gegangen sein als vielmehr um die harte Oberfläche. Dass „Alien: Romulus“ in der Zeitachse gleich hinter dem Original andockt, um diesem ganz nah zu sein, erscheint da nur folgerichtig. Es ist ein Fingerzeig für die anschließend aufgezogene, in ihrem Aufbau von vorne bis hinten vorhersehbare Dramaturgie, die ihrem legendären Vorbild in der Form nacheifert wie ein Zwilling dem anderen.

„Vor der Hacke ist es duster“, wie man im Bergbaugewerbe so schön sagt.
Bevor die Mimikry ihren Lauf nimmt, darf Alvarez aber zeigen, dass ihm bei allem drohenden Franchise-Gehorsam durchaus eine eigene künstlerische Vision vorschwebt. Was er da auf dem Planeten der Bergbaukolonie an hoffnungsloser Düsternis abbrennt, würde als Kulisse einem jeden möglichen neuen „Terminator“ schmeicheln, der in der Zukunft spielen könnte. Die klobigen „W“-Muster der Weyland Corp. breiten sich als schwere, rostige Skulpturen in einer Landschaft aus, die weder Flora noch Fauna kennt, sondern ausschließlich Maschinen, Staub und Barrieren unter einem verpesteten Himmel mit aufgewühlter Stratosphäre. Das gesamte Produktionsdesign, inklusive der später dominierenden Innereien der Raumstation, erinnert wohlig an die guten alten Zeiten des gehobenen Mittelklasse-Genrekinos, das aus den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln das Beste zu erschaffen vermochte, wie es zuletzt vielleicht noch „Riddick“ vor rund einer Dekade gelang.
Das All wirkt wie ein gigantischer, wild träumender Organismus im Winterschlaf, auf dessen Skelett Erkundungstouren stattfinden. Selbst Planetenringe werden bis auf die Oberflächenstruktur der einzelnen Gesteinspartikel aufgelöst, in der Luft scheinen unsichtbare Krankheiten zu schweben und die schwarzbraune Umgebung verhüllt unerschlossene Dinge, die nur kurz im Schein der wütenden Blitze zu erahnen sind. Es sind lediglich Fragmente, die man zu sehen bekommt, sie setzen sich jedoch zu einer überzeugenden Illusion zusammen, die wirkungsvoll das drohende Unheil ankündigt und für angemessene Stimmung sorgt, während sich die Facehugger noch in Position bringen.
Gebrochen wird die Illusion allenfalls durch den blutjungen Cast, ausschließlich aus Mittzwanzigern bestehend, deren weiche, noch nicht voll ausgeprägte Gesichtszüge viel von dem Schmutz absorbieren, den die Kulisse verströmt. Am Ende des Films wird man sich keines dieser Gesichter eingeprägt haben, mit Ausnahme vielleicht desjenigen von David Jonsson, der allerdings als Android auch eine äußerst dankbare Rolle zugewiesen bekommt, die er immerhin bravourös meistert: Ein zur trüben Miene eines verlassenen Hundes eingefrorenes Gesicht, das auf die emotionalen Trigger seiner Umgebung dann mit feinsten Nuancen reagiert, das kommt vielleicht nicht ganz an die spröde Nüchternheit von Charaktermimen wie Lance Henriksen oder Ian Holm heran, ist der Methodik dieser Pioniere aber zweifellos auf der Spur. Der künstliche Mensch ist und bleibt zudem ein faszinierendes Thema, das gerade auch den „Alien“-Diskursen immer schon eine zusätzliche Dimension verpasst hat.

Diese jungen Leute mit ihren modischen Kopfbedeckungen…
Letztlich interessiert sich das Skript aber nur am Rande für Roboterethik und Mensch-Maschine-Philosophie, denn im Vordergrund steht ganz technisch-banal der Spannungsaufbau. Es ist eine Fortsetzung, die am liebsten unsere Erinnerung an die alten Filme reinwaschen würde, die uns einen Erstkontakt vorgaukeln möchte, um selbst anstelle des Originals Platz nehmen und dessen Wirkung verströmen zu können. An Inszenierung und Pacing ist nur wenig auszusetzen. Grundsätzlich werden die Bausteine fachmännisch in Position gerückt. Wir sind weit weg von der postmodernen Ausschlachtung der Franchise in den 2000ern mit „Alien vs. Predator“, eher schon möchte man bei der langsamen Erkundung der Station an das gelungene Lizenzvideospiel „Alien: Isolation“ denken, vielleicht sogar an die Alien-inspirierte „Dead Space“-Franchise, obgleich all diese Spiele in Sachen Immersion naturgemäß die Nase vorn haben. Nichtsdestotrotz: Wenn die ersten Facehugger schlüpfen und ganze Räume in Beschlag nehmen, möchte man lieber auf der anderen Seite der Tür stehen.
Alvarez ist jedoch so sehr darauf bedacht, dem Publikum seine Fanlieblinge am Ende einer Kette von Andeutungen mit dem größtmöglichen Effekt vor den Latz zu knallen, dass er den Inhalt aus den Augen verliert. Die „Evil Dead“-Essenz hatte er noch bis auf den Kern freigelegt, ohne sich auch nur ansatzweise der Mittel Sam Raimis bedienen zu müssen; aber der „Alien“-Stoff ist da wohl spürbar eine größere Hausnummer als das Necronomicon. Diesmal begnügt sich der Regisseur damit, einfach die Handschrift abzupausen; und zwar nicht länger nur bei Ridley Scott, sondern auch bei James Cameron, bei David Fincher und schließlich sogar bei Jean-Pierre Jeunet. „Alien: Romulus“ gerät auf einmal zur Petrischale, in der munter Genmaterial angerührt wird, das aus allem möglichen Urschleim zusammengesetzt ist, nur keine einzige neue Zutat beizusteuern weiß, außer das ein oder andere brachiale Logik-Ozonloch.
So bekommen wir zwar mit zunehmender Eskalation der Ereignisse einige der skurrileren Einfälle zu sehen, die man mit Säure, Feuer, Munition und Schwerkraft realisieren kann, dies jedoch auf Kosten der Glaubwürdigkeit eines Skripts, das in den meisten Momenten dann doch eher auf Suspense setzt und gerade die Xenomorphs etwas dosierter einsetzt als etwa Camerons bleihaltige Pluralisierung „Aliens“. Wird diese dann doch mal als Vorbild herangezogen, fällt der gesamte Aufbau drumherum in sich zusammen. Hinzu kommen einige unglückliche SFX-Entscheidungen, denn trotz spürbarer Bemühungen, On-Set-Effekte in den Mittelpunkt zu stellen und computergenerierte Bilder eher ergänzend zu nutzen, wird in einem Fall unausgereiftes CGI zur Gesichtsanimation eingesetzt, wo sich eine hydraulische Puppe als Alternative regelrecht aufgedrängt hätte.

Kein guter Zeitpunkt für eine Atempause.
Weil aber eben der Fokus so sehr auf das How-To gelenkt ist und keinerlei Ambitionen zu erkennen sind, den Stoff auch inhaltlich zu erweitern, beginnt man sich trotz der düsteren Bilder, der griffigen Atmosphäre und des lückenlosen Spannungsaufbaus bald zu fragen, was dieser siebte Teil überhaupt zu einer Reihe beitragen kann, die ja grundsätzlich durchaus empfänglich ist für individuelle Ansätze. „Alien: Romulus“ ist womöglich der erste Teil, dem es kaum gelingt, sich aus den Schatten seiner Ahnen zu befreien. Substanz sucht man im Umgang des Films mit dem durchaus interessanten Romulus-Motiv aus der römischen Mythologie jedenfalls vergebens, es bleibt weitgehend bei Behauptungen und Feststellungen von Parallelen.
Lediglich im letzten Akt wird es nochmal ein Stück weit packend und unberechenbar. Vielleicht ist das Finale aus „Alien“, das hier neuerlich kopiert wird, in seiner Suspense-Kurve einfach zu perfekt, um nicht auch auf Alvarez‘ Regie positiv abzufärben, vielleicht ist die letzte Kreatur, die er aus dem Hut zaubert, auch einfach ein idealer Bezugspunkt, an dem sich die Geister scheiden können und an dem Diskussionen geboren werden, solange nur abgelenkt wird von der Vorhersehbarkeit des Drehbuchs.

Rain (Cailee Spaeny) hatte sich gerade erst an die Dunkelheit gewöhnt.
„Alien: Romulus“ ist letztlich ein Film, den James Cameron schon 1986 hätte drehen können, wenn ihm nichts besseres eingefallen wäre. Dass er dann doch lieber „Aliens“ drehte und die Eier bewies, Ridley Scotts Horrorthriller-Formel in eine SciFi-Action-Formel zu verwandeln, war ausschlaggebend dafür, dass sich „Alien“ überhaupt zu einer Autorenreihe entwickeln konnte, der bislang noch jeder Regisseur seinen Stempel aufdrücken konnte; Sigourney Weaver hin oder her. Fede Alvarez hingegen hat zwar durchaus die biologische, mechanische und mythologische Komponente der Giger-Kreaturen verstanden und inszeniert sie demgemäß furchteinflößend. Was ihm aber schmerzlich fehlt, ist der frische neue Ansatz, in den sie eingebettet werden können.
![]()
Schaut in den Trailer von „Alien: Romulus“
Sascha Ganser (Vince)
…
Mit „Prometheus“ und „Covenant“ hatte Ridley Scott höchstselbst die „Alien“-Reihe erweitern dürfen, hatte allerdings ganz offensichtlich eigenständige Sci-Fi-Werke über außerirdische Götter und Flöte spielende Androiden im Kopf, denen er dann widerwillig das „Alien“-Gewand überstülpen musste, um sie finanziert zu bekommen. Nach diesen umstrittenen bis ungeliebten Werken sollte es also back to the roots gehen, mit „Alien: Romulus“.
Fede Alvarez heißt der Mann für die Auf-Nummer-sicher-Nummer, der 2013 „Evil Dead“ zu großer Fanfreude rebootete und als Produzent sowie Storylieferant die 2022er-Version von „Texas Chainsaw Massacre“ mitverantwortete. Also spielt „Alien: Romulus“ dann auch folgerichtig zwischen Teil eins und zwei, beginnt mit der alles bestimmenden Entität im „Alien“-Kosmos, der Weyland-Yutani-Corporation. Eine Forschungsstation des Konzerns nimmt unbekanntes Material auf, um es zu untersuchen, danach wird abgeblendet, aber natürlich ist vollkommen klar, welches Grauen nun auf der Station passiert, die folgerichtig zum Haupthandlungsort des eigentlichen Films wird.
Selbiger spielt im Jahr 2142 und beginnt auf einem Minenplaneten, auf dem Jung und Alt für Weyland-Yutani schuften müssen. Als Belohnung für die Sollerfüllung winkt die Reise zu neuen Planeten im All, doch wie schnell diese Karotte weggezogen wird, merkt Protagonistin Rain (Cailee Spaeny), als sie für sich und ihren „Bruder“, den Androiden Andy (David Jonsson), das Ticket buchen will. Kurzerhand wird die Anzahl zu leistender Stunden verdoppelt, in sechs Jahren könne sie wiederkommen. Dass die Hauptfiguren jünger sind als in den Vorgängern, ist sicherlich mit Blick auf ein neues Zielpublikum angedacht worden, wird aber von Alvarez inhaltlich begründet: Die jungen Menschen wollen der lebensfeindlichen Hölle entfliehen, ehe sie an Staublunge, Unfällen oder Krankheiten krepieren wie ihre Eltern, während manche Ältere sich mit dem Schicksal abgefunden haben.
Rain und Andy werden kurz darauf von Tyler (Archie Renaux) angesprochen: Ihr Kumpel hat im Orbit des Planeten ein Schiffswrack entdeckt, auf dem er Kühlkammern vermutet, mit denen sie auf eigene Faust zum gelobten Planeten reisen können. Mit einer kleinen Crew brechen sie zu dem Schiff auf, das sich als jene Forschungsstation aus der Auftaktsequenz entpuppt…
Dass die klassischen „Alien“-Filme, vor allem der Ursprungsfilm der Reihe, Pate für „Alien: Romulus“ standen, ist ein offenes Geheimnis. Der Storyaufbau funktioniert sehr ähnlich, angefangen bei der ausführlichen Einführung von Figuren und Setting über die unvermeidliche Erstinfektion eines Crewmitglieds durch einen Facehugger bis zum Finale, in dem ein letzter Xenomorph noch die vermeintliche sichere Bastion stürmt und im Überlebenskampf besiegt werden muss. Auch sonst werden brav die Standards der Reihe bedient. Weyland-Yutani ist weiterhin der Raubtierkapitalismus in Reinform, der für Forschung im Namen der Profitmaximierung über Leichen geht. Überall sind Metaphern auf Sexualität und Geburt zu finden, hier noch dadurch auf die Spitze getrieben, dass mit Tylers Schwester Kay (Isabela Merced) eine Schwangere zum Team gehört. Hinzu kommt der Fanservice, von den Pulse-Gewehren über die Zitate mancher Onliner („Get away from her, you bitch“) bis hin zum (tricktechnisch etwas durchwachsenen) Auftauchen eines alten Bekannten.
Das geht meist in Ordnung, doch am meisten schwächelt „Alien: Romulus“ immer dann, wenn er zu sehr vom Franchise-Gedanken, vom Glauben an die eine große Geschichte getrieben wird. So handelt es sich bei dem Fundstück aus der Eingangssequenz, wie man später erfährt, nicht um irgendein Xenomorph-Material, nein, es ist das Biest aus dem ersten „Alien“, das trotz Treiben im Weltall und Brutzeltour im Raumschiffantrieb wohl immer noch nicht komplett kaputtbar war. Außerdem muss auch jene Flüssigkeit aus den Scott-Prequels noch einen Auftritt haben – hoffentlich um danach für immer aus der Franchise zu verschwinden. Sie sorgt allerdings dann für einen jener semi-gelungenen Xenomorph-Hybriden, die schon in „Alien – Die Wiedergeburt“ und den Prequels eher diskutabel als vollends gelungen waren. Dabei zeigt „Alien: Romulus“ oft wie reizvoll eine Geschichte mit neuen Figuren im „Alien“-Kosmos mit der bekannten Kreatur sein könnte, wenn man nicht andauernd den krampfhaften Anschluss an Gewesenes wie die Ripley-Saga suchen würde.
Denn in einigen der besten Momente des Films etabliert sich Alvarez dagegen vom Ursprungsmaterial. Die Szenen auf dem Minenplaneten greifen nicht nur die Malocher-Ästhetik der frühen Filme auf, sondern nehmen auch das ins Bild, was in den früheren „Alien“-Filmen nur am Rande vorkam: Die Zivilgesellschaft der Zukunft. Früher waren es isolierte Kleingruppen, noch dazu besondere Vertreter der Gesellschaft wie Soldaten („Aliens“) oder Strafgefangene („Alien 3“). Hier bekommt man zumindest eine Ahnung davon wie der Alltag auf manchen Planeten aussehen mag. Außerdem betritt „Alien: Romulus“ zumindest ansatzweise „Blade Runner“-Terrain, wenn es um Andy geht. Seine Figur und sein Status als künstlicher Menschen sind wesentlich zentraler als bei seinen Pendants aus der Ripley-Tetralogie, ohne dass „Alien: Romulus“ in die Schwafelgefilde der Prequels abdriften muss, ihnen denen der Android David einer der wichtigsten Charaktere war. Andy ist ein defekter Android, notdürftig von Rains Vater reaktiviert, das letzte Verbindungsstück zu den verstorbenen Eltern. Gespiegelt wird dies durch ein unsicheres Auftreten seinerseits, ein leicht autistisches Sprechen und ein Faible für Dad Jokes. Bei allen Interaktionen zwischen Andy und seinen menschlichen Kompagnons steht die Frage im Raum, inwiefern er ein vollwertiges Mitglied der Truppe oder doch nur ein Gebrauchsgegenstand ist, mit dessen Hilfe man beispielsweise wichtige Türen in der Station öffnen kann. Selbst seine „Schwester“ Rain ist von dieser Ambivalenz nicht ausgenommen.
Doch auch an anderer Stelle nutzt Alvarez den Raum für Experimente im Rahmen des Bekannten. In den vorigen Filmen (mit Ausnahme einer Spannungspassage im letzten Drittel von „Aliens“) waren die Facehugger oft nur Mittel zum Zweck, das nach der ersten Infizierung eines Crewmitglieds keine Rolle mehr spielten. In „Alien: Romulus“ sind sie eine massivere Bedrohung, etwa wenn sich mehrere Mitglieder der Crew im knietiefen Wasser befinden, während nach und nach mehrere eingefrorene Facehugger im gleichen Raum auftauen. An einer anderen Stelle müssen die Helden an den Biestern vorbeischleichen, getarnt durch die angehobene Raumtemperatur, doch jedes Schwitzen, jedes Signal von Angst verändert die eigene Körpertemperatur und macht sichtbar. An wieder einem anderen Punkt besitzen die Helden zwar Pulse-Gewehre, können diese aber wegen des Säurebluts der Xenomorphen nahe der Außenhülle nicht einsetzen, was in einer weiteren kreativen Passage mündet.
Das sind natürlich in erster Linie Akzente in einem Film, der sich primär an der Blaupause des Originals orientiert. Das passiert auch auf handwerklicher Ebene, denn Alvarez setzt vornehmlich oft handgemachte Sets und praktische Effekte, um auch optisch an jene anzuschließen. Auch das Design beim CGI-Einsatz lehnt sich harmonisch daran an, sieht man vom erwähnten Patzer beim Auftauchen eines alten Bekannten ab. Natürlich treten durch den Direktvergleich der Filme dann auch die Schwächen von Romulus zutage. So werden die Figuren zwar eingeführt, doch Kay und Pilotin Navarro (Aileen Wu) bleiben beinahe eigenschaftslos, während auch Rain angesichts ihrer Hauptrolle etwas zu wenig Profil besitzt. Überraschend markig kommt dagegen Tylers Cousin Bjorn (Spike Fearn) daher, dessen Ausagieren und Feindseligkeit Andy gegenüber einen Kern besitzen, der erst im Verlauf des Films offengelegt wird. Die andere Schwäche von „Alien: Romulus“ sitzt im letzten Drittel, wenn der Film manchmal etwas zu viel will, immer wieder einen draufsetzen möchte bei den ausweglosen Situationen und halsbrecherischen Passagen, sodass es manchmal doch eine Nummer zu sehr drüber wirkt.
Mit seinem jungen Cast besitzt „Alien: Romulus“ eine Kontinuität zu den Hauptfiguren aus den Alvarez-Filmen „Evil Dead“ und „Don’t Breathe“, auch wenn den meisten scriptbedingt nicht der Raum zum Glänzen gegeben wird. So ist die talentierte Cailee Spaeny („Civil War“) recht gut in der Hauptrolle, aber bei weitem nicht so ikonisch und memorabel wie das offensichtliche Vorbild Sigourney Weaver. Archie Renaux („Morbius“), Isabela Merced („Sicario 2“), Spike Fern („The Batman“) und Aileen Wu („The Chinatown Diner“) füllen ihre Rollen okay aus, aber mehr auch nicht, während David Jonsson („Deep State“) in seiner dankbaren Rolle aufgeht. Nicht nur, weil Andy die komplexeste Figur des ganzen Films ist, sondern später auch noch ein Persönlichkeits-Update erhält, wodurch der Schauspieler mehrere unterschiedliche Facetten verkörpern und zwischen diesen switchen muss.
Man kann „Alien: Romulus“ sicherlich vorwerfen, dass seine Ambitionen nicht zu hoch hängen, sondern dass er einfach Sci-Fi-Horror nach Bauart des ersten „Alien“ liefern möchte. Das macht er aber mit starken Set-Design, kreativen Spannungspassagen, sauberem Aufbau und gelungenem Tempo, auch wenn man an Details wie Charakterzeichnung die Qualitätsunterschiede zum Vorbild erkennt. Vielleicht wäre das Ergebnis noch besser ausgefallen, hätte Alvarez einfach nur eine Geschichte im „Alien“-Kosmos erzählen wollen und das Ergebnis nicht künstlich mit den Vorgängern verzahnen müssen. In Einzelpassagen zeigt er aber, dass er in der Tradition der ersten Filme tiefergehende Überlegungen im Genrerahmen anstellen kann, ohne dabei ins Geschwafel von Ridley Scotts letzten Esoquarktaschen verfallen zu müssen.
![]()
© Nils Bothmann (McClane)
„Alien: Romulus“ sollte ursprünglich direkt über den Streaming-Anbieter Hulu erscheinen, wurde dann aber doch noch für einen Kinostart freigegeben. Der SciFi-Horrorthriller läuft seit dem 15. August in den deutschen Kinos und damit einen Tag früher als in den USA. LEONINE wird zu einem späteren Zeitpunkt für die Heimkinoauswertung sorgen; Details zur Ausstattung, zu den Formaten oder zum Release-Datum sind momentan allerdings noch nicht bekannt.
Was hältst du von dem Film?
Zur Filmdiskussion bei Liquid-Love
| Copyright aller Filmbilder/Label: 20th Century Studios / Leonine__FSK Freigabe: FSK16__Geschnitten: Nein__Blu Ray/DVD: Nein / Nein (voraussichtl. ab 2024) |