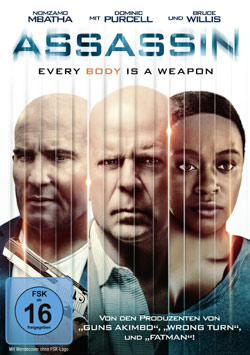| Originaltitel: Hellboy__Herstellungsland: USA__Erscheinungsjahr: 2019__Regie: Neil Marshall__Darsteller: David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane, Daniel Dae Kim, Alistair Petrie, Sasha Lane, Thomas Haden Church, Penelope Mitchell, Sophie Okonedo, Brian Gleeson, Kristina Klebe u.a. |

In Neil Marshalls „Hellboy – Call of Darkness“ tritt David Harbour als titelgebender Held gegen Milla Jovovich als Blutkönigin an
„Hellboy – Call of Darkness“, im Original ganz im Sinne des Reboot-Charakters nur „Hellboy“ genannt, löste bei der Ankündigung zwiespältige Gefühle aus. Einerseits hatte Guillermo del Toro sich mit Herzblut der Mike-Mignola-Comics angenommen, hatte charmante Fantasy-Action-Spektakel mit Witz und Sympathie für Monster geschaffen. Andrerseits waren beide Adaptionen kommerziell nur begrenzt erfolgreich, weshalb ein dritter del-Toro-Film wohl nicht mehr drin war und beim Reboot durch Millennium Films immerhin mit Neil Marshall („Centurion“) ein ebenfalls im Genre verwurzelter Regisseur übernahm.
Del Toro erweist „Hellboy – Call of Darkness“ aber dennoch mehrfach Tribut, so etwa in der ersten Sequenz in der Gegenwart, in welcher der titelgebende Dämon und paranormale Ermittler Hellboy (David Harbour) im Auftrag der Behörde B.P.R.D. nach einem verschwundenen Kollegen in Mexiko sucht. Der ist allerdings mittlerweile zum Vampir mutiert, räumt beim Lucha Libre, dem mexikanischen Wrestling, ab, und fordert Hellboy zum Kampf – auf Leben und Tod. Die Verweise auf del Toros Heimat Mexiko und dessen Kultur, die (nur angerissene) Tragik des Monsters, das einen Freund töten muss – all das sind kleine Verbeugungen vor dem Vorgängerregisseur.
In der Eröffnungssequenz ist dagegen bereits die Hauptantagonistin, Nimue (Milla Jovovich), die Blutkönigin, zu sehen, deretwegen der Film auch den Arbeitstitel „Hellboy: Rise of the Blood Queen“ trug. Die mächtige Hexe Nimue überzog das Land dereinst mit einer Pest und kommandierte Monsterhorden, doch durch einen Verrat ihrer Hexengefolgschaft gelang es König Arthur (Mark Stanley) sie zu erschlagen und ihre Körperteile über die Welt verstreut bestatten zu lassen. Das wird die Handlung in der Folgezeit nach England verlegen, also Neill Marshalls Heimatland, wobei dort in erster Linie einige Außenszenen gedreht wurden – den Großteil des Films fabrizierte Millennium Films in seinen Studios im Ostblock.
So soll Hellboy einerseits einem Ritterorden in England bei der Jagd nach drei marodierenden Riesen helfen. Andrerseits macht sich ein Feenwesen mit Schweinekopf im Auftrag der Hexe Baba Yaga auf die Suche nach Nimues Einzelteilen und setzt die Blutkönigin wieder zusammen. Schon bald kreuzen sich die Wege Hellboys und der Schurken, die eh noch eine Rechnung mit dem Dämonen offen haben…
Ein Reboot soll es also sein, eine Neuausrichtung, irgendwie düsterer und härter, deshalb auch mit R-Rating. Gleichzeitig will „Hellboy – Call of Darkness“ auch ein wenig auf der „Deadpool“-Welle surfen, dessen sarkastischen, reflexiven Humor mit übernehmen, doch die Melange ist unausgegoren, da gerade letzterer Ansatz nur hier und da verfolgt wird. Da streut der Erzähler mal ein „Ja genau, der König Arthur“ in den Off-Kommentar hinein, aber es bleibt bei derartigen Einsprengseln. Und die greisenhafte B.P.R.D.-Agentin, die auch mal zur Flinte greift und von Hellboy tatsächlich einen Ausweis sehen will, weil es eben Vorschrift ist, die hätte es auch schon bei del Toro geben können. Sowieso: Da steigt der Film eigentlich direkt ins Geschehen ein, ohne Origin Story und andere del-Toro-Elemente, scheint sich abnabeln zu wollen, und was passiert dann? Man bekommt die Origin Story und andere Scherze doch noch nachgereicht, womit „Hellboy – Call of Darkness“ leider sehr wackelig auf eigenen Beinen steht, sich trotz der Versuche Sachen anders zu machen als eher mäßig inspirierter Franchiseverwalterkram erweist.
Vor allem wird ein Unterschied zu den del-Toro-Filmen ebenso schnell wie schmerzlich bewusst: Wo sich del Toro sowohl für die ruppigen, freakigen Seiten als auch für den emotionalen Haushalt seiner monströsen Protagonisten interessierte, da ist es bei Neil Marshall und Drehbuchautor Andrew Cosby („Eureka – Die geheime Stadt“) nur ersteres. Hellboy ist ein Typ, der viel säuft, mehr oder weniger gelungene Oneliner klopft und sich die Hörner flext wie andere Leute sich rasieren, aber eben auch nicht mehr. Ein struppiger, verlotterter Held mit großer Klappe und netter Schale unter hartem Kern, bei dem aber alle Versuche von Vertiefung Behauptung bleiben: Sein Hadern mit der eigenen Herkunft, die Ziehvater Professor Broom (Ian McShane) ihm jahrelang verschwieg, seine Beziehung zu Alice Monaghan (Sasha Lane), die er als Baby aus der Hand diebischer Feen rettete. Nichts davon will so wirklich für sich einnehmen, alles bleibt an der Oberfläche.
So könnte „Hellboy – Call of Darkness“ sicherlich als reiner Fantasy-Actionfilm dann durchaus Laune machen, aber auch da wechseln sich Licht und Schatten ab. Als größtes Problem erweist sich auch hier das Drehbuch, das teilweise arge Schwierigkeiten mit der Verbindung seiner Set-Pieces hat. Warum Hellboy von A nach B muss, von der Kooperation mit dem Ritterorden über Scharmützel mit der Blood Queen hin zum Treffen mit dem Geist Merlins – all das ist viel zu unorganisch, baut oft auf Zufälle und Willkür. Würde etwa eine Figur an einer Stelle nicht verwundet werden, würde Hellboy nicht auf die Suche nach einem Heilmittel gehen, bei der er gleichzeitig wichtige Infos für seine Mission bekommt, die er andrerseits nicht erhalten hätte.
Aber zwischendrin gibt es immer wieder Szenen, in denen Film, Titelfigur, Regie und Creature Designer sich mal austoben können. Das Budget ist niedriger als bei den Höllenjungen von del Toro, was man manchem CGI-Effekt auch ansieht, aber in Sachen Creature Design stehen die Kreativleute den früheren Verfilmungen kaum nach: Da tauchen groteske Feenwesen auf, da haust Baba Yaga in einem verschnörkelten Haus auf Hühnerbeinen, da gehen die Geisterbeschwörungen der übersinnlich begabten Alice eher in den Bereich des Body Horror usw. Leider kann man die Arbeit und Liebe zum Detail oft gar nicht so bewundern. Im Finale etwa steigen Höllenwesen in London auf, die aussehen als ob sie beim Kaffeekränzchen von Hieronymus Bosch, Francisco Goya und H.P. Lovecraft erdacht worden wären, ziehen ein paar unschuldige Opfer auf links – und tauchen nach rund 30 Sekunden Wüten nie wieder so richtig im Film auf. Sowieso: Der Film mag sein R-Rating mit überzeugenden handgemachten und weniger überzeugenden CGI-Schmaddereien durchaus ausnutzen, wirkt aber immer etwas hingeworfen dabei. Es werden diverse mehr oder weniger unschuldige Leute dahingemetzelt, aber das ist zu wenig gruselig zur Erzeugung von Grauen, zu unlustig für Funsplatter und die Opfer sind zu egal, um damit das Ausmaß der Bedrohung wirklich zu verdeutlichen.
httpv://www.youtube.com/watch?v=6QEYTQB5GnM
Der Mix aus praktischen Tricks und Computer-Unterstützung spielt auch in die Actionszenen hinein. Mal darf die Stuntcrew sich austoben, etwa wenn Lobster Johnson (Thomas Haden Church) in der Origin-Story-Rückblende unter Naziwachen aufräumt, mal ist in erster Linie Effektcrew gefragt, gerade bei den Kloppereien der Superwesen. Manchmal ist das inszenatorisch durchaus pfiffig gemacht, etwa bei Hellboys Kampf gegen die Riesen, in dem die Kamera von Lorenzo Senatore („Northmen – A Viking Saga“) dem Helden durch das Gewimmel folgt, bei dem Hellboy (und der Zuschauer gleich mit) den Überblick behalten muss. Manchmal ist das Ganze allerdings eher dröger Standard, was vor allem auf das Finale zutrifft. Eine coole Idee spart sich Marshall für eine Nachklappactionszene auf, in der Hellboy und seine Getreuen zu den Klängen von Mötley Crües „Kickstart My Heart“ unter Feinden aufräumen und damit den Abspann einleuten – und den treibenden Song nicht so wie „Shoot ‘Em Up“ zur reinen Credituntermalung verschwenden. Natürlich bleiben am Ende noch Handlungsfäden offen, die Post-Credit-Sequenz teasert geradezu das angedachte Sequel inklusiver neuer und alter Schurken an.
Hauptbezugspunkt des Ganzen ist David Harbour („Sleepless – Eine tödliche Nacht“), gerade dank „Stranger Things“ ganz heiß im Geschäft, und der macht seine Sache auch nicht schlecht. Schlechter als Ron Perlman zwar, aber der war auch die Idealbesetzung. Harbour legt seinen Hellboy als verständnisvolles Raubein in der Tradition seines „Stranger Things“-Sheriffs an und macht das auch recht gut, hat eher Probleme damit, dass das Drehbuch ihm nicht immer tolles Material an die Hand gibt. Das dagegen bekommt Ian McShane („John Wick: Chapter 2“), der zwar nur Support bleibt, aber in seinen Szenen regelmäßig den Film zu klauen droht. In weiteren markanten Nebenrollen leisten Sasha Lane („American Honey“) und Daniel Dae Kim („Die Bestimmung – Insurgent“), als tougher B.P.R.D.-Veteran, Brauchbares, während Milla Jovovich („Future World“) als Blutkönigin bei geringer Screentime Akzente zu setzen weiß: Ihre Schurkin ist herrisch, mörderisch, aber auch von nachvollziehbaren Motiven getrieben, was sie etwas komplexer als einen bloßen Bösewicht mit Weltbeherrscher-Phantasien macht. Für eine kurze Gastrolle schaut Thomas Haden Church („Daddy’s Home“) vorbei, der Rest vom Fest dagegen ist wenig prägnant und erwähnenswert.
So bleibt mit „Hellboy – Call of Darkness“ unterm Strich ein Film, der nicht direkt schlecht, aber einfach reichlich egal und uninspiriert ist. Neill Marshall und seine Crew verwalten das Erbe del Toros mit wenigen eigenen Ideen, die der Film viel zu selten wirklich ausspielen darf, kriegen keinen einheitlichen Ton zwischen düsterem Splatter und lockerer „Deadpool“-Coolness auf die Kette und haben wenig Sinn für die Figuren. Dank einiger gelungener Set-Pieces, einem starken Creature Design und einiger starker Darsteller ist „Hellboy – Call of Darkness“ aber noch ganz okay, trotz des eher mauen Scripts. Überzeugende Reboots sehen dann aber doch anders aus.
Knappe:
![]()
© Nils Bothmann (McClane)
……
Dass die wirtschaftliche Denke eines Studios nichts mit Qualitätssicherung zu tun hat, dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben. Bisweilen führt das zu Marktstrategien, die gelinde gesagt merkwürdig anmuten. Im Fall von „Hellboy“ jedenfalls hätte Guillermo del Toro zur Komplettierung der von ihm gestarteten Trilogie bereit gestanden, sofern man ihm erlaubt hätte, wieder mit Ron Perlman in der Titelrolle ein eigenes Skript zu verfilmen. Nur ist del Toro inzwischen ein recht großer Name, bei dem man wohl in der Kosten-Nutzen-Relation ein Minusgeschäft erwartete, zumal die 66 Millionen Dollar Produktionskosten des ersten Teils in der Fortsetzung bereits 25 Prozent höher ausfielen; eine Entwicklung, die sich in einem dritten Teil mit Sicherheit fortgesetzt hätte, nicht nur der Inflation wegen („Hellboy II: The Golden Army“ ist immerhin bereits mehr als zehn Jahre alt). Dafür reicht das Vertrauen in die Stärke der Marke wohl nicht aus. Aber anstatt das Projekt zu begraben, werden lieber Zugeständnisse gemacht; kein del Toro mehr, kein Perlman, das Budget sinkt auf 50 Millionen und zur Entschuldigung zieht mal wieder jemand die wunderbare Reset-Formel „Reboot“ aus der Tasche, mit der sich das Weh-Weh und Buh-Buh der Produzenten einfach ins Nirwana schnippen lässt. Neil Marshall, der letztmalig 2010 mit „Centurion“ einen richtigen Film drehte, wird es schon richten. Und das Publikum soll die offerierte Light-Version mindestens genauso gut finden wie die beiden besser ausgestatteten Filme, die es schon kennt, so dass möglichst viel Kohle in die Kassen gespült wird… für eine teurere Fortsetzung dann wohl.
Geld ist aber natürlich schon beim ersten Versuch sehr wichtig, gerade wenn man Fantasy drehen möchte. Und ja, der neue „Hellboy“ hat so seine lieben Probleme, was die Wertigkeit des Augenfutters angeht. Das kommt wohl auch daher, dass er klotzen möchte wie die ganz Großen und ihm deswegen nichts anderes übrig bleibt, als seine Mittel großflächig zu verteilen. Im Ergebnis stehen Spezialeffekte von sehr unterschiedlicher Qualität. Die Hexe Baba Yaga und ein Wer-Eber nach Bebop-Bauart gehören zu den am besten ausgearbeiteten, reinen Fantasy-Gestalten des Films, auch weil ihnen ausreichend Zeit gewidmet wird und die On-Set-Darsteller ihnen mit spezieller Gestik, Haltung und Fortbewegung Persönlichkeit einimpfen. Dennoch sind auch ihre Gesichter mit dem Kleister der virtuellen Übermalung stigmatisiert, so dass sie letztlich wie all ihre Artgenossen als CGI-Kreaturen ein digitales Dasein fristen. Sonstiges Ungeziefer kommt da noch weniger gut weg: Die drei hässlichen Goliaths in einer frühen Actionsequenz müssen tollpatschige Verwandte der Steintrolle aus Peter Jacksons erstem „Hobbit“ sein, folgen sie doch denselben Slapstick-Regeln in ihr unvermeidliches Ende, das sie im Kampf gegen einen roten David im vom Zufall geleiteten Abwehrmodus finden. Die vielen kleinen Minion-Gnome indes, von denen die Blutkönigin anfangs umringt ist (immerhin kein Computergesicht, sondern nur Computer-Körperteile: Milla Jovovich fein filetiert), sind bloß blubbernde Masse, die in Babysprache ziellos irgendwelche Laute von sich geben. Das Nebeneinander dieser unausgereiften Monster-Ergüsse und der deutlich feiner konturierten Hauptkontrahenten Hellboys erinnert fast ein wenig an die alte „Ghostbusters“-Zeichentrickserie: Auch hier wurden grobschlächtig gezeichnete Geistermassen als Vorgeschmack auf das Chaos in der Geisterwelt gerne ins Bild gesetzt, während die eigentlichen „Ghosts Of The Week“ wesentlich liebevoller umgesetzt waren. Auf die gleiche Weise möchte man hier nun andeuten, in welcher Gesellschaft die Jovovich ihre letzten 1500 Jahre verbracht hat.
Schlimmer als die durchwachsenen Spezialeffekte fällt allerdings der reduzierte Aufwand in Sachen Setdesign ins Gewicht, insbesondere, da aus unerfindlichen Gründen ständig der Vergleich mit del Toro gesucht wird. Schon die Behausung Hellboys, die nur zu Beginn kurz gezeigt wird (it’s a Road Movie!), hebt sich nicht nennenswert von den Entwürfen der ersten Filme ab, wirkt aber in jeder Hinsicht eine Nummer bescheidener. Und das ist nur der Auftakt: kleinere Einsatzzentrale, kleinere Showdowns, kleinere Gadgets. Selbst die Hörner werden nicht mehr funkensprühend mit der Schleifmaschine getrimmt, sondern mit einer Nagelfeile. Richtig auffällig wird es aber, als sich Baba Yaga und Hellboy an einem festlich gedeckten Bankett gegenübersitzen: Da kann man einfach nicht anders, als an den „Pale Man“ aus „Pan’s Labyrinth“ zu denken… und das oscarprämierte Szenenbild und Make-Up mit diesem hier zu vergleichen. Wer als Sieger hervorgeht, dürfte klar sein – und diesmal ist nicht die Nostalgie schuld.
Aber es ist nicht einmal das Budget, das den neuen „Hellboy“ blindlings in eine Sackgasse steuert, es ist die fehlende Vision. Del Toros Interpretation war sicher nicht unumstritten (vor allem nicht Teil 2), sie fußte aber auf einer konkreten Vorstellung davon, wie man die Hauptfigur einbetten sollte und auf welchen Weg man sie bringen würde. Marshall hingegen muss einen richtig geilen Höllenritt auf dem Regiestuhl gehabt haben, denn es sieht nicht so aus, als habe er zu Anfang gewusst, wohin ihn die Reise am Ende führen würde. Zwar schmeißen die Dialogschreiber mit diffusen Andeutungen um sich, kaum dass die Stifte zu kreiseln begonnen haben. Die Story, die sich irgendwo zwischen Babyentführer-Feen, Merlins und Kirchentore einreißenden Schweinemonstern spannt, wird aber mit dem Rücken zum Zuhörer erzählt, als ginge sie ihn gar nichts an. Es ist zwar schön, dass auf das übliche Origins-Einführungsgeplapper verzichtet wird, aber muss man deswegen so desinteressiert am eigenen Plot sein?
Verständnis dafür entwickelt man aber, als man zu verstehen beginnt, dass die Autoren (Andrew Cosby für das Drehbuch, Mike Mignola durch die Vorlage) sich mit einer klassischen Evil-Rising-Story ohne raffinierte Extra-Note zufrieden geben, die man wegen der „portionierten“ Rückkehr der Villainess ins Reich der Lebenden noch am ehesten mit „Die Mumie“ vergleichen kann. Für ein solches Kopisten-Vorgehen hat sich bislang noch keine Autorenbrust stolz schwellen dürfen. Während der häufige Tourist von Fantasiewelten die Einfältigkeit in der Story jedoch zu tolerieren weiß (wo er doch selten genug Besseres zu sehen bekommt), verlangt er aber zumindest nach einer klaren Vorstellung, welche Richtung eingeschlagen werden soll in Sachen Charakterentwicklung, Drehbuchablauf und letztlich vor allem Atmosphäre. Hier nun scheinen aber unterschiedliche Teams völlig autonom an unterschiedlichen Szenen gearbeitet zu haben. Der Schwarzweißprolog mit rot ausgeschnittenem Käppi verheißt ja schon nichts Gutes (Van-Helsing-Vibes anyone?) und in der Tat: Auch im Anschluss lässt die Produktion optisch eine klare Marschrichtung vermissen. Vampir-Wrestling im Schmuddelschuppen, Gigantenkloppe auf der Wiese bei Sonnenschein, Londoner Plattenbauromantik bei Nacht, Ausflüge in neblige Traumwelten und die Entweihung heiliger Stätten lassen den Eindruck einer TV-Serie entstehen, die sich Episode für Episode fortentwickelt… was nicht der Anspruch eines Kinofilms sein kann.
Weil man jedoch vermutlich schon während der Produktion von einer kurzen Halbwertszeit ausging, packte man im Dienste des schnellen Erfolgs einfach noch ein paar Trends in die Formel, die sich am Box Office zuletzt für Filme vergleichbarer Größendimensionen bewährt hatten. Wer schon explizit in einem eigens dafür geschnittenen Trailer mit dem R-Rating werben muss, hat damit höchstwahrscheinlich Dinge zu kompensieren. Die in diesem Comic-Abenteuer gezeigte Gewalt ist tatsächlich von bemerkenswerter Radikalität und kann durchaus schocken – nicht etwa wegen der Gewalt an sich, sondern wegen der Erkenntnis, wie fatal man ihre Qualitäten als Würzmittel missverstehen kann. Wenn hier Kiefer ausgerissen oder Köpfe gehäutet werden, glaubt man ein dummes Kind zu beobachten, das gerade in einer Zaubershow gesehen hat, wie der Magier seine Assistentin entzwei teilte… um das Gleiche am Brüderlein mit Mamas Küchenmesser auszuprobieren. Dabei sagte Deadpool doch klar und deutlich: Nicht nachmachen, Kinder!
Immerhin an den Darstellern gibt es eher wenig zu meckern, obschon David Harbours Interpretation des Höllenjungen nicht jedem schmecken dürfte. Während Ron Perlman ihn wie ein trotziges Kind mit zu viel Kraft anlegte, versucht sich Harbour auch mal an der selbstmitleidigen Tour. Man hört den großen Jungen öfter mal vor Schmerzen oder Verzweiflung wimmern, zwischen die durchaus immer noch vorhandenen Badass-Momente mischt sich auch mancher Moment der Verunsicherung und nach den Mid Credits kommt sogar noch ein wenig Fanboyism dazu. Bei Kostüm und Maske sind nur wenige Unterschiede zu verzeichnen; in einem Cosplay-Wettbewerb würden sich beide Darsteller wohl um den ersten Platz streiten. Harbours Maske erlaubt allerdings etwas mehr Schauspiel, Perlman wirkt vergleichsweise versteinert im Gesichtsbereich. Es ist wohl Geschmackssache, wen man bevorzugt, obwohl es schlicht und ergreifend nicht möglich ist. an einem Perlman in Sachen Charisma vorbeizuziehen.
Auch Milla Jovovich rechtfertigt ihr Casting mit einer guten Leistung. Ihre Schönheit aus Leeloo-Zeiten hat sie sich bewahrt, während sich ihre Gesichtszüge während des Alterns ein wenig verhärtet haben – die perfekte Besetzung für den Typus „böse Königin“. Und Ian McShane als Hellboys Paps, was soll man da schon Negatives anbringen? Sasha Lane bleibt als Helferin mit magischen Fähigkeiten eher unauffällig. Daniel Dae Kim hat seine Rolle derweil von Ed Skrein geerbt, der sie freiwillig abgetreten hat, um eine Whitewashing-Kontroverse zu verhindern. Hätte Kim gesehen, wie seine finale Jaguar-Gestalt in Aktion aussieht, hätte er es sich vielleicht noch einmal überlegt…
Das größte Kompliment, das man diesem Reboot from Hell machen kann: Es wird wohl einige Zuschauer geben, die während der Sichtung den Guilty-Pleasure-Effekt durchleben. Aufgrund der sinnlosen Gewalt, der Nonstop-Action, der blöden Sprüche und der vielen, vielen Kreaturen werden sie sich königlich amüsieren, sehr wohl darum wissend, welchem Käse sie hier aufsitzen. Käse bleibt dieser „Hellboy“ 2.0 aber trotzdem, daran ändert kein „more blood, more gore, more badass“ etwas. Wir haben ja den Direktvergleich.
![]()
Universum Film bringt „Hellboy – Call of Darkness” ab 11. April 2019 ungekürzt ab 16 Jahren freigegeben in die deutschen Kinos.
© Sascha Ganser (Vince)
Was hältst du von dem Film?
Zur Filmdiskussion bei Liquid-Love
| Copyright aller Filmbilder/Label: Universum Film__FSK Freigabe: ab 16__Geschnitten: Nein__Blu Ray/DVD: Nein/Nein, ab 11.4.2019 in den deutschen Kinos |