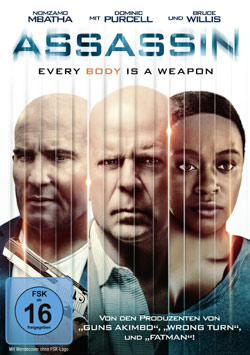| Originaltitel: The Predator__Herstellungsland: USA/Kanada__Erscheinungsjahr: 2018__Regie: Shane Black__Darsteller: Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Olivia Munn, Jacob Tremblay, Thomas Jane, Keegan-Michael Key, Sterling K. Brown, Alfie Allen, Augusto Aguilera, Yvonne Strahovski, Jake Busey, Lochlyn Munro, Françoise Yip u.a. |

In “Predator: Upgrade” lässt Regisseur und Co-Autor den außerirdischen Jäger mit psychisch angeknacksten Ex-Soldaten kämpfen
Kritik von McClane:
Seine Nebenrolle in „Predator“ war für Shane Black, der danach als Drehbuchautor und später Regisseur („Iron Man 3“) Karriere machte, eines des ersten Engagements in Hollywood. 2018 kehrt er in letzteren Eigenschaften für eine erneute Fortsetzung der Reihe zurück, an seiner Seite seinen alten Kumpan Fred Dekker („Night of the Creeps“) als Co-Autor des Scripts.
Es kommt dieses Mal mehr als ein Predator auf die Erde, wobei Elitesoldat und Scharfschütze Quinn McKenna (Boyd Holbrook) Erstkontakt mit nur einem Wesen hat, als er und sein Team Drogendealer bei einer Geiselübergabe in Mexiko ausschalten sollten. Es kommt zum Kampf, den Quinns Team nicht überlebt, während er den Predator schwer verletzen und einige Ausrüstung mopsen kann, die er an sein Postfach schickt – das dummerweise aufgelöst wurde, weshalb das Equipment seinem hochintelligenten, unter Asperger-Syndrom leidenden Sohn Rory McKenna (Jacob Tremblay) in die Hände fällt, der bei Quinns Ex-Frau Emily (Yvonne Strahovski) lebt.
Schnell laufen die Maßnahmen der Regierung an: Man sackt den verletzten Predator und alle Fundstücke an der Absturzstelle ein, bestellt die mit Aliens befasste Wissenschaftlerin Casey Brackett (Olivia Munn) ins Labor und versucht Quinn aus dem Verkehr zu ziehen, indem man ihn für verrückt erklärt. Zusammen mit einer anderen Gruppe von Soldaten, denen man psychische Probleme diagnostiziert hat, packt man ihn in einen Gefängnisbus, womit Black und Dekker eine ähnlich illustre Gruppe vorstellen wie das Söldnerteam in „Predator“ oder die Polizeieinheit in „Predator 2“: Da sind Kettenraucher Nebraska Williams (Trevante Rhodes), der dauernd Witze erzählende Coyle (Keegan Michael-Key), der an Tourette leidende Baxley (Thomas Jane), der Sprengmeister Lynch (Alfie Allen) und Bibelfreak Nettles (Augusto Aguilera).
Brackett veranlasst, dass die Gefangenen noch zum Labor gebracht werden, damit sie Quinn befragen kann. Währenddessen kann sich der gefangene Predator jedoch befreien, diverse Wachen töten und aus dem Labor fliehen. Das Wesen macht sich auf den Weg zu seiner Ausrüstung – und damit zu McKennas Haus. Deshalb brechen er und seine neuen Vertrauten aus und machen mit Casey Jagd auf den Predator, dem jedoch noch ein weiterer, geupgradeter Predator folgt…
httpv://www.youtube.com/watch?v=g8zx_dtm2J4

Quinn McKenna (Boyd Holbrook) mit Sohnemann Rory (Jacob Tremblay)
Black hat Erfahrung mit der „Predator“-Reihe gesammelt, die auch schon im Ursprungsfilm einiges an Ironie und lockeren Machosprüchen bot, doch eigentlich sind Blacks Drehbücher seit seinem Erstling „Lethal Weapon“ noch mehr auf Oneliner und Comedy getrimmt, was man auch „The Predator“, hierzulande „Predator: Upgrade“ getauft, anmerkt. Die Sprüche erinnern teilweise eher an „Last Boy Scout“, gerade wenn Coyle das Tourette seines Kumpans Baxley mit Witzen über dessen Mutter herausfordert, während auch die Marotten der geistig versehrten Ex-Soldaten (noch eine Parallele zu „Lethal Weapon“) Aufhänger für flotte Sprüche und schräge Situationen sind, etwa wenn diese auf das Verhalten Caseys nach Erwachen aus einer Ohnmacht wetten oder im Eigenheim der McKennas einer Ansprache lauschen, auf die sie jedoch anders reagieren als erwartet.
So mag der Ton etwas lockerer sein, die Horror-Elemente etwas weniger betont als in den Vorgängern, doch insgesamt bleibt auch „Predator: Upgrade“ dem Stil der Reihe treu. Wenig zimperlich schnetzeln sich der Predator und seine Artverwandten durch ihre Gegner, wobei hier anfangs in erster Linie gesichtslose Soldaten und Wissenschaftler den Aliens zum Opfer fallen, ehe schließlich in der zweiten Hälfte auch die illustre (Anti-)Heldentruppe nach und nach dezimiert wird. Mit herausgefallenem Gedärm, blutigen Treffern und abgetrennten Gliedmaßen wird auch der Härtegrad der Vorgänger gehalten, entgegen Fanbefürchtungen des angeblichen Weichspülens des Stoffs.

Quinn mit Teilen seiner neuen Truppe: Nebraska (Trevante Rhodes), Coyle (Keegan Michael-Key), Baxley (Thomas Jane) und Nettles (Augusto Aguiliera)
So funktioniert „The Predator“ über weite Strecken als gelungener Actionreißer, in dem die Heldentruppe, die Regierungsagenten, der Predator und ein weiterer Jäger aus dessen Heimat sich Mehrfrontenkriege liefern. Die Action ist nicht zu schnell geschnitten, verliert nur hin und wieder mal die Übersicht und liefert neben einem Hauen und Stechen, vor allem mit Predator-Waffen, in erster Linie Shoot-Outs und dicke Explosionen. Der eine oder andere schicke Stunt, etwa ein umkippender Gefängnisbus, ist ebenfalls zu bewundern, während Black und Dekker immer wieder Verweise auf die Vorgänger einbauen: Genannte frühere Sichtungen des Predator erinnern sowohl an die Handlungs- als auch Erscheinungsjahre der Vorgänger (wir erinnern uns: „Predator 2“ spielt 1997), Dialogzeilen wie „Kontaaaakt“ werden wiederholt und Jake Busey („Dead in Tombstone 2“) spielt einen Wissenschaftler namens Keyes, höchstwahrscheinlich den Sohn des Geheimdienstlers Peter Keyes, den sein Vater Gary Busey in „Predator 2“ verkörperte. Zudem wird öfter diskutiert, ob das Wesen nicht eher ein Sportjäger als ein Raubtier ist – „Hunter“ war ein ursprünglich geplanter Titel für den Original-„Predator“. Aber vermutlich kamen die Produzenten zum gleichen Urteil wie die Regierungsagenten im Film: „Predator“ klingt cooler als „Hunter“.
Das sind alles keine schlechten Voraussetzungen und doch macht „The Predator“ nicht komplett glücklich. Zum einen fehlt der Truppe die Chemie, welche die eingespielten Teams aus Teil 1 und 2 hatten: Hier müssen sich alle noch kennenlernen, sodass es seltsam erscheint, wenn die Teammitglieder nach wenigen Stunden des Überlebenskampfes füreinander sogar in den Tod gehen. Einzig und allein die respektvolle Annäherung zwischen Quinn und Nebraska überzeugt, aber als Spezialist für Buddy-Movie-Scripts von „Lethal Weapon“ und „Last Boy Scout“ über „The Long Kiss Goodnight“ und „Last Action Hero“ bis zu „Kiss Kiss, Bang Bang“ und „The Nice Guys“ ist Shane Black auch auf dem Gebiet beschlagen genug. Nur die Dramatik und die Dynamik manch früherer Black-Arbeit erreicht auch das Zusammenspiel der beiden nicht, die Gesamttruppe eh nicht.

Wissenschaftlerin Casey Brackett (Olivia Munn) steht McKenna im Kampf gegen den Predator zur Seite
Dabei stimmt das Casting durchaus. Boyd Holbrook („Logan: The Wolverine“) wird nicht wie Arnold Schwarzenegger in die Actiongeschichte eingehen, macht aber einen guten Job, auch wenn Trevante Rhodes („12 Strong“) als knallharter Partner mit Abgründen ihn noch etwas aussticht. Olivia Munn („X-Men: Apocalypse“) ist ebenfalls recht brauchbar als Wissenschaftlerin mit Tough-Girl-Qualitäten, während ausgerechnet die als schlagkräftige „Chuck“-Agentin bekannte Yvonne Strahoski zur besseren Stichwortgeberin wird. Ähnlich hat es auch Thomas Jane getroffen, der nach einem guten Start mit Werken wie „Deep Blue Sea“ und „The Punisher“ es doch nicht in die Actionstarliga schaffte, und hier nur Randerscheinung bleibt, ähnlich wie Augusto Aguilera („Chasing Life“) und Alfie Allen („John Wick“). Einzig und allein Keegan Michael-Key („Stichtag – Schluss mit gemütlich“) kann seine Komikerpersona gewinnbringend in den Film einbauen. Jacob Tremblay ist nicht auf dem Vorschusslorbeerenniveau seiner Darbietungen aus „Raum“ und „The Book of Henry“, nervt aber im Gegensatz zu anderen Kinderdarstellern auch nicht.
Ein anderes Problem des Films bezieht sich allerdings auf die Erweiterung der Predator-Saga. Interessant ist sicherlich der Ansatz den Jagden der Predators mehr Hintergrund zu geben. Das verknüpft Black dann noch mit Themen wie Klimawandel und der etwas bananigen These, dass Asperger nach Ansicht mancher Wissenschaftler keine Störung, sondern die nächste Stufe der Evolution ist. Vor allem laufen diese Erweiterungen allerdings darauf hinaus, dass man am Ende schon den Grundstein für ein oder mehrere Sequels legt, mit einer grauenhaften letzten Sequenz, die an Dreistigkeit und Blödheit zum übertreffen ist. Außerdem merkt man „Predator: Upgrade“ phasenweise auch an, dass das Endergebnis ein paar Nachdrehs und Umschnitte über sich ergehen lassen musste: Mancher Ansatz wird fallen gelassen, nicht alle Anschlüsse passen und einige Szenenfolgen irritieren, etwa wenn man erst so wirklich erfährt, dass ein paar Figuren in den letzten Szenen abwesend waren, weil sie nun mit einem geklauten Helikopter anrücken.
So hinterlässt „Predator: Upgrade“ dann gemischte Gefühle: Shane Black bleibt dem Rezept des Originals treu und liefert durchaus harte, temporeiche Sci-Fi-Horror-Action mit einer illustren Heldentruppe, weitestgehend gelungenen Effekten und druckvollen Spektakelszenen. Leider ist die Interaktion der Figuren nicht immer überzeugend, der Film dramaturgisch nicht immer rund (was wohl auf die Produktionsgeschichte zurückzuführen ist) und die Erweiterungen des Predator-Mythos manchmal interessant, manchmal diskutabel und manchmal sogar richtiggehend übel.
Knappe:
![]()
Kritik von Vince:
Diese lang erwartete Fortsetzung der „Predator“-Reihe, die erste seit langer Zeit mit echter Ur-DNA, hätte eigentlich gar keines Castings bedurft. Man hätte sich stattdessen einfach eine Citroën-Ente organiseren können, um damit durch Kleinstädte zu streifen, herrenlose Clowns aufzugabeln und diese im Dschungel auszusetzen. Den Rest würde schon die Buddy-Chemie erledigen.
Clowns gab es natürlich auch schon im allerersten Film von 1987 – unter anderem eben jenen Witzbold, der nun auf dem Regiestuhl Platz nimmt. Shane Black schreibt virile Gruppendialoge wie kein Zweiter, das hat sich in all den Jahren nicht verändert. In der Luftblase politischer Korrekt- und Beherrschtheiten, in der wir momentan leben und der zunehmend giftige Gase in Form latenter Aggression entweichen, funktionieren dumme Witze über Mamas und Oralbefriedigung an Obdachlosen wie Nadeln, sie bringen das behutsam aufgebaute Konstrukt (vemeintlichen) gegenseitigen Respekts rüpelhaft zum Platzen. Das ist wesentlich effizienter als die postmodernen Verrenkungen, die ein „Deadpool“ auf sich nehmen muss, um ähnliche Dinge zu erreichen. Black bevorzugt hier eher die gerade Luftlinie von A nach B und haut uns das maskuline Gebaren längst ausrangierter Männer-Modelle vor den Latz, als wäre er immer noch 26 Jahre alt und umgeben von engen Jeans, öligen Muskeln und wahlweise strengem Militärschnitt oder wallender Vokuhila-Mähne.
So gesehen ist „Predator – Upgrade“ tatsächlich die erste „echte“ Fortsetzung seit Teil 2 aus dem Jahr 1990, wurde der Rastafari-Sportjäger aus dem Weltall in den „AvP“-Filmen doch entgegen seiner Art mit geschmolzener Popcorn-Butter überzogen und im Versuch von 2010 zum Aufhänger für einen uninspirierten Testlauf gemacht, ob der Stoff in diesem Jahrzehnt überhaupt noch zündet. Um solche Alleingänge schert sich Black nicht. Es geht ihm bloß um die Dynamik innerhalb einer drastisch überzeichneten Männergruppe, die regelrecht in Handicaps ersäuft und trotzdem die Muskeln spielen lässt, als gäbe es keinen Morgen. Was natürlich für einen Großteil der Besetzung, soweit ist uns das Prinzip der Dezimation noch bekannt, auch so kommen wird. Und so kommt beim hemmungslosen Gesplattere an den Pausenclowns kindliche Freude auf, als ginge es um G.I.Joe-Actionfiguren im Sandkasten eines Kindergartens. Die Getroffenen quittieren ihr Schicksal oft mit einem Schulterzucken; „ist halt so“, scheinen ihre Gesichter zu sagen, bevor sie um einige Körperteile erleichtert abtreten und fortan ihrem Schöpfer auf den Nerv gehen.
Woran sich Black nicht mehr erinnern mag, es ist ja schließlich auch schon über 30 Jahre her, das Gefeixe diente damals dem Überspielen von nackter Angst. Die Bedrohung aus dem Unsichtbaren ließ wandelnde Monumente wie Bill Duke und Carl Weathers zu Bronzestatuen erstarren, denen das Kondenswasser von der perfekt geformten Linienführung ihrer Brustmuskeln tropfte (nur Schwarzenegger war am Ende selbst für einen erfahrenen Alien-Jäger wohl einfach eine zu harte Nuss). Der Truppengang durch den mittelamerikanischen Dschungel war wie ein auffälliges Pfeifen im Walde, übertüncht vom Gelächter der Dschungeltiere und der Überlegenheit des Herausforderers. Doch niemals hätten amerikanische Soldaten sich zu ihren Ängsten bekannt. Die schon ewig schwelende Ost-West-Konflikt hatte seine Spuren hinterlassen, die dieser Film gnadenlos aufdeckte.
Black mag mit seiner ureigenen Handschrift in gewisser Weise die alte Schule verfolgen, doch das bedeutet noch längst nicht, dass er eine Kopie des Originals anfertigen würde. Dass er an den Paranoia- und Thriller-Elementen weniger interessiert sein würde, macht bereits der Establishing Shot im Weltall deutlich: Traditionellerweise ruht ein solcher schwerelos im Vakuum, bis ein Raumschiff vor die Linse rückt. Hier jedoch bewegt sich die bis dahin passive Kamera mit, als werde sie vom Fahrtwind (…?) des Schiffs mitgesogen. Es folgen blinkende Knöpfe, Absturz-Chaos und die Inszenierung der fancy Alien-Technologie. Keine langsame Einführung also, nein, das Alien wird mit dem Wissen um 30 Jahre Predator-Filmkultur ent-alienisiert. Und man ahnt schon Übles.
Die Späße der irdischen Clowns als Reaktion auf den Besucher dienen folglich nicht mehr als Angst-Ventil, sondern grundsätzlich nur noch dazu, sich gegenseitig aufzuputschen und in Form zu bringen für ein völliges Chaos von Film. Für echte „Predator“-Hardliner resultiert das unweigerlich zu einer großen Enttäuschung, denn nervenzerrende Anspannung weicht einer Non-Stop-Entladung; wie in diesen 90er-Jahre-Gameshows, in denen man möglichst viele Luftballons zertrampeln musste, um zu gewinnen. In der Tat muss sich dieser Film fragen lassen: Was hat er sich bloß bei diesem Kokolores gedacht? Da werden Dschungelgebiete ebenso durchstreift wie Vorstadtparks, eine Erzählung aus Kinderaugen wird mit allen erdenklichen Klischees aufgebaut, um dann einfach zu verwaisen, es kommen Predator-Hunde ins Spiel, mit denen man die beliebte Gesellschaftsdebatte „wenn sich Hunde und ihre Besitzer ähnlich sehen“ wieder zum Leben erwecken könnte, am besten gleich im Double Feature mit „Es gibt immer einen noch größeren Fisch im Teich – über Hollywood und seine Superlative“. Erstaunlich, dass Black es in diesem Durcheinander trotzdem irgendwie schafft, einen Bus voller Idioten mit so etwas Ähnlichem wie Charisma auszustatten und somit eine der größten Schwäche des 2010er Vorgängers auszumerzen. Boyd Holbrook funktioniert als Hauptdarsteller in diesem Kontext ebenso gut wie seine Mitspieler (hier vor allem der völlig geschmacklos zur Tourette-Marionette umfunktionierte Thomas Jane), seine Ehefrau (sieht hübsch aus und passt auf das Eigenheim auf: Yvonne Strahovski) und nicht zuletzt diverse Charaktervisagen in weiteren Nebenrollen, darunter Edward James Olmos, Lochlyn Munro und der wie immer wunderbare Jake Busey.
Irgendwo tief im Herzen des Filmliebhabers schlummert eine Astralebene, auf deren Wellenlänge „Predator – Upgrade“ sogar irgendwie funktioniert. Die Voraussetzung dafür ist, dass man Hoffnungen auf eine Neuauflage von McTiernans Klassiker tunlichst vermeiden sollte. Shane Black trifft immerhin den zeitgeistigen Chic der Empörung über Unangemessenheit jeder Art tief ins Herz, ohne sich dafür allzu sehr im Irrgarten der Postmoderne zu verirren. Aber manchmal, wenn man beispielsweise der außerirdischen Hundekreatur in die treudoofen Augen blickt, da denkt man sich im Stillen ja schon: War das jetzt wirklich nötig?
Gute:
![]()
20th Century Fox bringt „Predator: Upgrade” am 13. September 2018 in die deutschen Kinos. Der Film bekam in seiner ungekürzten Fassung eine Freigabe ab 16 Jahren. Das 3D sieht ganz gut aus, ist aber – wie so häufig – jetzt auch kein großer Vorteil oder zwingendes Muss bei dem Film. Seit dem 24. Januar 2019 sind außerdem Heimkinoversionen in verschiedenen Ausführungen zu erwerben: als normale DVD und Blu-ray, als limitiertes Blu-ray-Steelbook und als 4K-UHD. Auf den Discs befinden sich entfallene Szenen, Hinter-den-Kulissen-Features, ein Rückblick auf die Reihe und der Kinotrailer. Im März folgt noch eine limitierte Box mit allen vier Teilen und Predator-Statue.
© Nils Bothmann (McClane)
© Sascha Ganser (Vince)
Was hältst du von dem Film?
Zur Filmdiskussion bei Liquid-Love
| Copyright aller Filmbilder/Label: 20th Century Fox__FSK Freigabe: ab 16__Geschnitten: Nein__Blu Ray/DVD: Nein/Nein, ab 13.9.2018 in den deutschen Kinos |